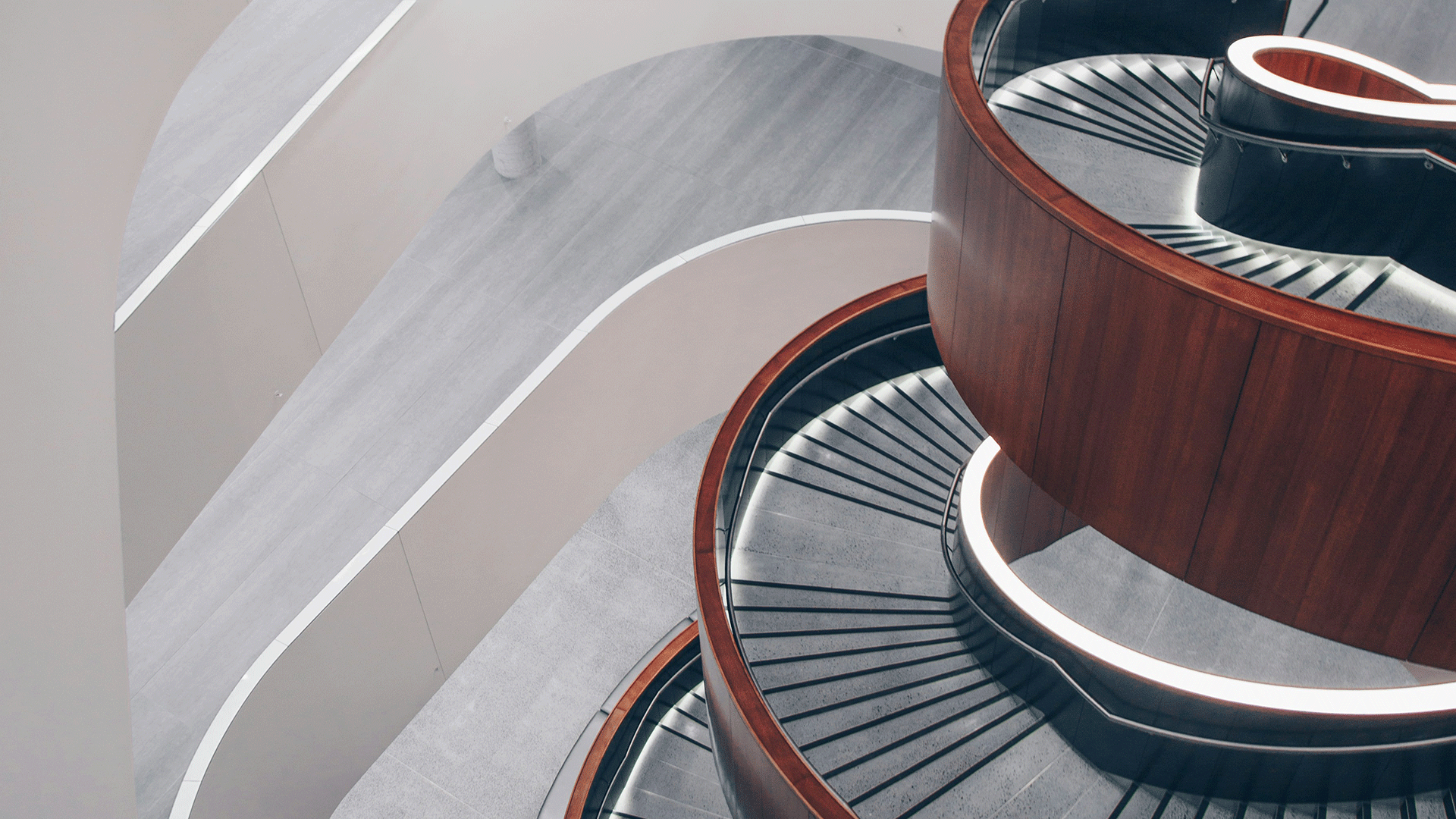
Lexikon Arbeitsrecht
Alle Stichworte
Die Abfindung ist eine Einmalzahlung, die von Arbeitgebern bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses als Kompensation für den Verlust des Arbeitsverhältnisses und sonstigen möglicherweise noch bestehenden Ansprüchen aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt wird. Grundsätzlich gibt es außerhalb einer freiwilligen Einigung keinen Anspruch auf eine Abfindungszahlung in einer bestimmten Höhe.
Wird eine Abfindung verabredet, ermittelt sich die Summe aus der beiderseitigen Interessenlage: Im Regelfall möchte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigen, der Kündigungsschutz gemäß Kündigungsschutzgesetz oder anderen Vorschriften steht einer rechtswirksamen Kündigung jedoch entgegen. In diesem Fall dient die Abfindung dazu, dem Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis sozusagen „abzukaufen”. Beim Aushandeln einer angemessenen Abfindungssumme kommt es nicht zuletzt auf das Geschick des rechtlichen Vertreters des Arbeitnehmers an. Orientierungspunkte für die Festsetzung einer Abfindungssumme können das Lebensalter, das Bruttomonatsgehalt und die Betriebszugehörigkeit sein. Maßgeblich wird jedoch immer die Risikolage der Arbeitgeberseite sein, den Beendigungswunsch einseitig nicht durchdrücken zu können.
Sonderfälle, in denen Ansprüche auf Abfindung bestehen:
- Ein Anspruch auf Zahlung einer Abfindungssumme außerhalb einer Einigung besteht im Rahmen des § 1 a KSchG: In diesem Paragraph eröffnet der Gesetzgeber dem Arbeitgeber die Möglichkeit, eine Abfindungssumme in Höhe von einem halben Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr freiwillig anzubieten, sofern der Arbeitnehmer auf Kündigungsschutzklage verzichtet. Der Anspruch auf die Abfindungssumme entsteht somit automatisch mit verstreichen lassen der Klagefrist.
- Die Arbeitsgerichte können wegen Unzumutbarkeit der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis auflösen. In diesem Falle ist gemäß §§ 9, 10 KSchG eine angemessene Abfindungssumme festzusetzen. Hier entsteht der Anspruch auf Abfindungszahlung auf Grund des Urteils.
- Im Rahmen von Sozialplänen werden z. B. bei Massenentlassungen oder Betriebsschließungen Abfindungsformeln festgesetzt, welche sich wiederum an Lebensalter, Betriebszugehörigkeit und Bruttomonatsgehalt orientieren. Es kann Sonderzahlungen z. B. für Kinder oder bei sozialen Belastungen geben.
Die Abfindungssumme wird einkommensteuerrechtlich als Einkommen gewertet, das heißt sie unterfällt im Regelfall voll der Einkommensteuerpflicht. Auf sie ist der Solidaritätsbeitrag zu entrichten. Andere soziale Abgaben, wie Arbeitslosenversicherung oder Krankenversicherung, fallen jedoch auf die Abfindungssumme nicht an.
Mithilfe einer Abmahnung beanstandet der Arbeitgeber ein vertragswidriges Verhalten seines Arbeitnehmers. Abmahnungsberechtigt ist jedoch nicht nur der Arbeitgeber selbst, sondern auch jeder weisungsbefugte Vorgesetzte.
Wann liegt eine wirksame Abmahnung vor?
Entgegen weit verbreiteter Ansicht kann eine Abmahnung auch mündlich erfolgen. Eine Schriftform ist nicht erforderlich, dem Arbeitgeber jedoch aus Beweisgründen zu empfehlen.
Eine wirksame Abmahnung muss weiterhin folgende Voraussetzungen erfüllen:
- klare Beschreibung des gerügten Verhaltens sowie dessen Bewertung als arbeitsvertragliche Pflichtverletzung (Dokumentationsfunktion)
- klare Aufforderung sich zukünftig vertragsgerecht zu verhalten (Hinweisfunktion)
- Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen bis hin zur Kündigung für den Wiederholungsfall (Warnfunktion)
Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die bloße Rüge oder Ermahnung. Zwar rügt der Arbeitgeber auch hier ein bestimmtes Verhalten des Arbeitnehmers als nicht vertragsgemäß, jedoch verzichtet er darauf, für den Wiederholungsfall arbeitsrechtliche Sanktionen anzudrohen.
Kann ich wegen des abgemahnten Fehlverhaltens noch eine Kündigung erhalten?
Hat der Arbeitgeber wegen einer gerügten, arbeitsvertraglichen Pflichtverletzung eine Abmahnung ausgesprochen, so hat er hinsichtlich dieses konkreten Fehlverhaltens auf den Ausspruch einer Kündigung verzichtet. Der Grund ist verbraucht und kann nicht zugleich Gegenstand einer Kündigung sein.
Bedarf es stets drei Abmahnungen vor Ausspruch einer Kündigung?
Eine feste Regel, wonach eine Kündigung stets drei vorherige Abmahnungen erfordern soll, existiert nicht. Eine verhaltensbedingte Kündigung setzt in aller Regel eine einschlägige Abmahnung voraus. Im Einzelfall kann jedoch auch eine Kündigung ohne vorherige Abmahnung wirksam ausgesprochen werden oder zu ihrer Wirksamkeit mindestens zwei einschlägige Abmahnungen notwendig sein. Entscheidend ist hierbei vor allem der Grad der gerügten Pflichtverletzung.
Welche Reaktionsmöglichkeiten habe ich nach Erhalt der Abmahnung?
Nach Ausspruch der Abmahnung wird diese in die Personalakte aufgenommen. Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, eine Gegendarstellung zu verfassen, welche ebenfalls in die Personalakte aufzunehmen ist. Wegen einer unberechtigten Abmahnung kann sich der Arbeitnehmer auch beim Betriebsrat beschweren und diesen um Unterstützung bitten. Zudem hat er die Möglichkeit, die Entfernung aus der Personalakte zu verlangen. Ist der Arbeitgeber dazu nicht bereit, kann der Arbeitnehmer auch gerichtlich gegen die unberechtigte Abmahnung vorgehen.
Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis wegen eines erneuten, vergleichbaren Pflichtverstoßes, so kann der Arbeitnehmer die Abmahnung aber auch noch im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses überprüfen lassen. Erweist sich die Abmahnung als unwirksam, so entfällt in der Regel die Grundlage für die verhaltensbedingte Kündigung.
Vertragliche Arbeitsbedingungen wie Tätigkeiten, Arbeitszeiten oder Entgelt kann der Arbeitgeber einseitig nur ändern, indem er eine Änderungskündigung ausspricht. Man unterscheidet zwischen unbedingter und bedingter Änderungskündigung. In beiden Fällen gilt für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer gleichermaßen: Fristen müssen beachtet werden.
In der Änderungskündigung wird das Ende des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen und das Angebot eines neuen Arbeitsvertrags zu geänderten Bedingungen (unbedingte Änderungskündigung) unterbreitet. Manchmal wird auch ein Angebot gemacht und für den Fall der Ablehnung des Angebotes gekündigt (bedingte Änderungskündigung).
Der Arbeitnehmer / die Arbeitnehmerin hat drei Reaktionsmöglichkeiten:
- Man nimmt das Angebot an und akzeptiert die neuen Arbeitsbedingungen ab dem angebotenen Zeitpunkt. Diese Willenserklärung sollte dem Arbeitgeber in schriftlicher Form möglichst umgehend zugehen.
- Man antwortet auf die Änderungskündigung nicht und das Arbeitsverhältnis endet zum angegebenen Datum.
- Man nimmt das Änderungsangebot auch unter dem Vorbehalt der sozialen Rechtfertigung an und lässt die Rechtmäßigkeit der Änderung gerichtlich überprüfen.
Wird ein neuer Vertrag nicht angenommen (2. und 3.) muss sowohl die Klage gegen die Beendigungskündigung (vgl. 2.) als auch eine Änderungsschutzklage (vgl. 3.) innerhalb von drei Wochen beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht werden. Will man das Angebot auch nur vorbehaltlich annehmen, so muss diese Erklärung grundsätzlich auch innerhalb von drei Wochen beim Arbeitgeber eingehen. Das fristgerechte Einreichen einer Klage reicht hier nicht aus, da damit lediglich der Zugang bei Gericht herbeigeführt wird.
Unter Arbeitspapieren versteht man die Gesamtheit der mit dem Arbeitsverhältnis im Zusammenhang stehenden Unterlagen und Dokumente. Hierunter fallen das Arbeitszeugnis, die Lohnsteuerkarte, die Urlaubsbescheinigung und Unterlagen über die betriebliche Altersversorgung. In bestimmten Bereichen gibt es besondere Arbeitspapiere: im Baugewerbe die Lohnnachweiskarten, im Lebensmittelgewerbe das Gesundheitszeugnis, bei Jugendlichen die Gesundheitsbescheinigung sowie die Arbeitserlaubnis bzw. Arbeitsberechtigung bei Ausländern, die nicht aus EU-Staaten stammen.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber zu Beginn des Arbeitsverhältnisses die für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses erforderlichen Arbeitspapiere auszuhändigen (z.B. Lohnsteuerkarte und Arbeitserlaubnis). Der Arbeitgeber ist seinerseits für die Dauer des Arbeitsverhältnisses verpflichtet, die Arbeitspapiere sorgfältig zu verwahren. Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses muss der Arbeitgeber die Arbeitspapiere richtig erstellen und dem Arbeitnehmer vollständig übergeben. Herauszugeben sind die Arbeitspapiere am Ort der Arbeitsstätte. Nur wenn der Arbeitgeber die Übergabe der Arbeitspapiere bis zum letzten Arbeitstag versäumt, kann er sie dem Arbeitnehmer übersenden. Um Beweisprobleme zu vermeiden, sollten beide Parteien zum Nachweis eine Quittung über die ausgehändigten Arbeitspapiere verlangen. Eine verspätete Herausgabe von Arbeitspapieren durch den Arbeitgeber kann zu Schadensersatzansprüchen des Arbeitnehmers führen. Für Streitigkeiten sind die Arbeitsgerichte zuständig.
Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist der von einem Arzt ausgestellte, schriftliche Nachweis, dass der Arbeitnehmer erkrankt ist und ihn dies an der Erbringung der Arbeitsleistung hindert. Sie ist Anspruchsvoraussetzung für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und die Gewährung von Krankengeld durch die gesetzliche Krankenversicherung.
Vorlagepflicht
Bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Kalendertagen muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) grundsätzlich eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Der Arbeitgeber kann hierauf verzichten. Der Arbeitgeber hat allerdings nach § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG die Möglichkeit, vom Arbeitnehmer bereits vor Ablauf von drei Kalendertagen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu verlangen. Dieser Grundsatz wurde aktuell vom Bundesarbeitsgericht (BAG) mit Urteil vom 14.11.2012 (Az.: 5 AZR 886/11) bestätigt.
Danach steht es im freien Ermessen des Arbeitgebers, ob er bereits am ersten Tag ein Attest vom Arbeitnehmer verlangt. Er benötigt insoweit weder eine Begründung noch einen Sachverhalt, der Anlass für den Verdacht eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens des Arbeitnehmers gibt. Unzulässig ist die Weisung des Arbeitgebers nur dann, wenn sie willkürlich erfolgt. Das Gesetz weist dem Arbeitgeber somit ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht (Direktionsrecht) zu, auf dessen Grundlage er die frühere Vorlage anordnen kann.
Soweit es technisch möglich ist, muss die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung noch am ersten Tag übergeben werden.
Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit berechnet sich nach Kalendertagen. Für die Frage, wann die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dem Arbeitgeber vorgelegt werden muss, kommt es dagegen auf die Arbeitstage an; deren Bestimmung erfolgt nach der individuellen Arbeitsverpflichtung des erkrankten Arbeitnehmers. Danach kann auch ein Sonntag verpflichtender Übergabetag für die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sein, wenn der Arbeitnehmer an diesem Tag eine Arbeitsverpflichtung hatte. Eine Rückdatierung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nur in Ausnahmefällen möglich und soll zwei Tage nicht überschreiten.
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit
Bei einer Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit über den zunächst bescheinigten Termin ist der Arbeitnehmer gemäß § 5 Abs. 1 Satz 4 EFZG zur Vorlage einer Folgebescheinigung verpflichtet. Eine Pflicht, dem Arbeitgeber die Folgebescheinigung noch vor Ablauf der ersten Arbeitsunfähigkeit oder alsbald nach Ausstellung durch den Arzt vorzulegen, lässt sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen.
Inhalt der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
Der die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellende Arzt muss nicht nur eine Erkrankung feststellen, sondern vielmehr die Tatsache der Arbeitsunfähigkeit. Zudem ist auch die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu testieren. Die Ausstellung der Bescheinigung durch ärztliches Hilfspersonal oder einen Heilpraktiker genügt nicht.
Der Arbeitnehmer hat die freie Wahl, welchen Arzt er aufsuchen will; er kann nicht gezwungen werden, sich an einen bestimmten Arzt wie den Betriebs- oder Werksarzt zu wenden.
Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach § 5 Abs. 1 EFZG
Einer im Inland ordnungsgemäß ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt im Rahmen der richterlichen Beweiswürdigung ein hoher Beweiswert zu; mit ihr besteht eine tatsächliche Vermutung, dass der Arbeitnehmer infolge Krankheit arbeitsunfähig war. Grundsätzlich gilt diese Vermutung auch für im Ausland ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen.
§ 275 Abs. 1a SGB V beschreibt in Regelbeispielen, unter welchen Voraussetzungen Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen. Es handelt sich zum einen um den Fall, dass der Arbeitnehmer häufig für eine kurze Dauer arbeitsunfähig ist oder der Beginn der Arbeitsunfähigkeit oft auf einen Tag am Beginn oder am Ende der Woche fällt. Zum anderen wird der Fall genannt, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von einem Arzt herrührt, der durch die Häufigkeit der von ihm ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auffällig geworden ist.
Weitere Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit bestehen dann, wenn
- der Arbeitnehmer sein Fernbleiben nach einer Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeber oder nach einer Weigerung ankündigt, Urlaub zum gewünschten Termin zu gewähren;
- der Arbeitnehmer widersprüchliche Angaben zum Hergang eines die Arbeitsunfähigkeit herbeiführenden Unfalls macht;
- der Arbeitnehmer sich nicht so verhält, wie es von einem Kranken erwartet wird; wobei Arbeitsunfähigkeit nicht zwingend häusliche Ruhe voraussetzt;
- der Arbeitnehmer während der attestierten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung einer Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber nachgeht, oder
- der Arbeitnehmer der Aufforderung einer Begutachtung durch den Medizinischen Dienst nicht nachkommt.
Rechtsfolgen bei Verletzung der Vorlagepflicht
Nach § 7 EFZG besitzt der Arbeitgeber ein Zurückbehaltungsrecht und ist daraus berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu verweigern, solange der Arbeitnehmer die von ihm nach § 5 Abs. 1 EFZG vorzulegende ärztliche Bescheinigung nicht vorlegt oder der ihm nach § 5 Abs. 2 EFZG obliegenden Verpflichtungen nicht nachkommt. Darüber hinaus kommt eine Abmahnung durch den Arbeitgeber in Betracht. Im Wiederholungsfall droht dem Arbeitnehmer auch der Verlust des Arbeitsplatzes nach einer verhaltensbedingten Kündigung; im Extremfall ausnahmsweise sogar nach einer außerordentlichen Kündigung.
Wenn ein Arbeitnehmer arbeitet, sind diese Zeiten zu vergüten. Die Wochenarbeitszeit ist in der Regel im Arbeitsvertrag festgehalten und das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) definiert die Arbeitszeit als die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne Ruhezeiten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 ArbZG). Sie beginnt mit dem Erreichen der Arbeitsstätte und endet mit deren Verlassen. Auch Zeiten, in denen sich der Arbeitnehmer uneingeschränkt und arbeitsbereit zur Verfügung halten muss, werden als Arbeitszeit eingeordnet (sog. Arbeitsbereitschaft). Die genannten Zeiten sind ohne anderweitige Regelungen vergütungspflichtig. Das ist eindeutig. Da es im Alltag nicht immer so klar ist, finden Sie hier einige typische Situationen und deren arbeitsrechtliche Bewertung.
Unklar sind immer wieder Zeiten, in denen Beschäftigte keine „Vollarbeit“ leisten. Ist die Wahrnehmung eines Arzttermins während der Arbeitszeit erlaubt und muss der Arbeitgeber diese Zeit bezahlen? Erhält der Mitarbeiter eine zusätzliche Vergütung, der zu einem Termin morgens um 6:00 Uhr losfahren muss, und der Arbeitstag bis um 20:30 Uhr dauert?
Recht eindeutig ist Sachlage im Falle eines Arzttermins. Denn hier kann eine Arbeitsunfähigkeit vorliegen und der Arbeitgeber ist dann zur Entgeltfortzahlung verpflichtet. Bei Routineuntersuchungen muss nach § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) der Arbeitgeber vorübergehende, nicht erhebliche Fehlzeiten des Arbeitnehmers vergüten, soweit die Verhinderung auf persönlichen Gründen beruht, wenn also z.B. der behandelnde Arzt keinen Termin außerhalb der Arbeitszeit anbieten kann. Aber Vorsicht: die Anwendung des § 616 BGB kann arbeitsvertraglich ausgeschlossen sein. Dann hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Gehaltszahlung bei kurzfristiger Verhinderung. Ein unbezahlter Urlaub wird aber zu genehmigen sein.
Bei Dienstreisen sind zwei große Themenkomplexe abzugrenzen: Sind Dienstreisezeiten Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes? Und müssen Dienstreisezeiten vergütet werden?
Die erste Frage bemisst sich nach der arbeitsschutzrechtlichen Beurteilung im Sinne des ArbZG. Ordnet der Arbeitgeber an, dass während der Reise Arbeitstätigkeiten ausgeübt werden müssen (Aktenstudium, Telefonkonferenzen etc.), handelt es sich um Arbeitszeit. Nutzt der Arbeitnehmer aber öffentliche Verkehrsmittel und arbeitet währenddessen freiwillig und ohne Anweisung des Arbeitgebers, ist die Reisezeit keine Arbeitszeit im Sinne des ArbZG. Wird der Arbeitnehmer dagegen angewiesen, ein Auto selbst zu fahren, ist die Dienstreise regelmäßig als Arbeitszeit zu werten, da keine Erholungsmöglichkeit besteht. Das gilt nur dann nicht, wenn ihm das Fortbewegungsmittel freigestellt ist und er aus eigener Entscheidung mit dem PKW fährt.
Ob Reisezeiten auch vergütet werden müssen, ist zunächst abhängig von speziellen Regelungen, etwa in Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag. Fehlt es an einer speziellen Regelung, ist für eine Vergütungspflicht ausschlaggebend, ob für die Reisetätigkeit den Umständen nach eine Vergütung zu erwarten ist (§ 612 Abs. 1 BGB). Das ist etwa bei Dienstreisen während der regulären Arbeitszeit der Fall. Wird die reguläre Arbeitszeit überschritten, ist dies allerdings umstritten. Für Angestellte in leitender Position hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) schon einmal angenommen, dass zwei Stunden Reisezeit, die über die reguläre werktägliche Arbeitszeit hinausgehen, mit dem Gehalt abgegolten sind. Der Werkstattarbeiter hätte hier sicherlich einen Anspruch auf Vergütung, wenn es sich um eine vom Arbeitgeber angeordnete Ausnahme handelt.
Nachdem das BAG in der Vergangenheit mehrfach entschieden hatte, „dass es keinen allgemeinen Rechtssatz gebe, nach dem Reisezeiten stets oder regelmäßig zu vergüten seien“, hat es in einer aktuellen Entscheidung (BAG, Urt. v. 17.10.2018 – Az. 5 AZR 553/17) diese Sichtweise modifiziert. So seien erforderliche Reisezeiten im Rahmen einer Auslandsdienstreise in der Regel zu vergüten – und zwar auch solche, die über die normale Arbeitszeit hinausgehen. Werden die Auslandsreisen ausschließlich im Interesse des Unternehmens vorgenommen, sind sie auch wie Arbeitszeit zu vergüten.
Weitere Artikel rund um das Thema „Arbeitszeit“:
Ein Aufhebungsvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, welche die einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu bestimmten, individuell ausgehandelten Konditionen regelt. Er unterscheidet sich vom Abwicklungsvertrag, der die Einzelheiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach einer erfolgten Kündigung festlegt. Dem Aufhebungsvertrag geht keine Kündigung voraus.
Wirksamkeit des Aufhebungsvertrags
Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Aufhebungsvertrag bedarf, ebenso wie die Kündigung, gemäß § 623 BGB der Schriftform. Es kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aufgelöst werden. Unerheblich ist auch, ob Kündigungsgründe vorlagen und eine Kündigung sozial gerechtfertigt wäre. Eine diesbezügliche Überprüfung durch das Arbeitsgericht im Rahmen eines Kündigungsschutzverfahrens findet nicht statt.
Eine Anhörung des Betriebsrats ist ebenso entbehrlich wie behördliche Zustimmungen im Falle eines bestehenden Sonderkündigungsschutzes.
Eine Anfechtung des Aufhebungsvertrags ist nur unter engen Voraussetzungen wegen Irrtums, widerrechtlicher Drohung (mit einer Kündigung) oder arglistiger Täuschung möglich. Die Beweislast für sämtliche Voraussetzungen des Anfechtungstatbestands und damit auch für die Widerrechtlichkeit einer Drohung trägt der anfechtende Arbeitnehmer.
Vertragsinhalt
Die Parteien sind bei der Gestaltung des Aufhebungsvertrags grundsätzlich frei.
Da der Arbeitnehmer durch den Abschluss eines Aufhebungsvertrags auf seinen Kündigungsschutz verzichtet, wird ihm der Arbeitgeber die Auflösung des Arbeitsverhältnisses regelmäßig durch Zahlung einer Abfindung versilbern. Einen gesetzlichen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung hat der Arbeitnehmer bei Abschluss eines Aufhebungsvertrags nicht.
Auch die unwiderrufliche Freistellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Fortzahlung der Vergütung sowie Regelungen über die Erteilung eines qualifizierten Zeugnisses mit guter Leistungs- und Verhaltensbeurteilung sollen die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses für den Arbeitnehmer attraktiv machen.
Risiken des Aufhebungsvertrags
Die zunächst vorteilhaft erscheinenden Vereinbarungen können bei genauerer Betrachtung erhebliche Nachteile für den Arbeitnehmer mit sich bringen. Insbesondere gilt dies für den Bezug des Arbeitslosengelds. Der Abschluss eines Aufhebungsvertrags führt gemäß § 159 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB III regelmäßig zu einer Sperrzeit von bis zu 12 Wochen. Der Arbeitslose hat sich durch die Auflösung seines Arbeitsverhältnisses ohne wichtigen Grund versicherungswidrig verhalten.
Ferner kann es bei Abfindungszahlungen wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäß 158 SGB III zu einem Ruhen des Arbeitslosengeldanspruchs kommen, sofern das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist beendet wurde.
Wissenswertes für Betriebsräte: Betriebsänderung
Bei einer Betriebsänderung hat der Betriebsrat umfangreiche Mitbestimmungsrechte. Wann eine Betriebsänderung vorliegt, ist in § 111 BetrVG beschrieben. Die Vorschrift ist anwendbar, wenn das jeweilige Unternehmen mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt. Darüber hinaus ist erforderlich, dass der Arbeitgeber eine Änderung des Betriebes plant, die wesentliche Nachteile für die Belegschaft oder jedenfalls einen erheblichen Teil davon zur Folge haben kann.
Die Norm zählt die praktisch relevanten Fälle von Betriebsänderungen auf. Bei diesen Beispielen wird vermutet, dass wesentliche Nachteile für die Belegschaft entstehen. Dabei handelt es sich um die Einschränkung, Stilllegung oder Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen sowie den Zusammenschluss und die Spaltung von Betrieben. Auch grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks oder der Betriebsanlagen sowie die Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfahren sind erfasst.
Bei der Beantwortung der Frage, ob sich die Nachteile auf einen erheblichen Teil der Belegschaft auswirken, orientiert sich die Rechtsprechung an den Zahlenverhältnissen des § 17 KSchG. Diese Vorschrift gilt unmittelbar nur für die Anzeigepflicht bei Massenentlassungen, wird aber schon lange auch zur Auslegung des § 111 BetrVG herangezogen. § 17 KSchG enthält eine an der Betriebsgröße orientierte Staffelung. So ist beispielsweise in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern erforderlich, dass 10 Prozent der Belegschaft oder mehr als 25 Arbeitnehmer betroffen sind.
Liegt eine Betriebsänderung vor, muss der Arbeitgeber den Betriebsrat über seine Planungen vollständig und rechtzeitig informieren. Auf Basis der dem Betriebsrat zur Verfügung gestellten Informationen hat der Arbeitgeber den Abschluss eines Interessenausgleichs mit dem Betriebsrat zu versuchen. Der Interessenausgleich regelt, ob und wie die konkret geplante Betriebsänderung stattfindet. Es ist auch möglich, im Interessenausgleich Kündigungsverbote oder aber Namenslisten zu vereinbaren.
Während der Arbeitgeber eine Einigung über einen Interessenausgleich nur versuchen muss, besteht beim Sozialplan ein zwingendes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats. Der Sozialplan befasst sich mit dem Ausgleich oder der Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitnehmern infolge der Betriebsänderung entstehen. Der Sozialplan wirkt wie eine Betriebsvereinbarung, sodass sich die betroffenen Arbeitnehmer unmittelbar auf die durch ihn begründeten Ansprüche berufen können. Kommt es zu keiner Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat über den Sozialplan, kann der Betriebsrat die Einigungsstelle anrufen. Wenn Nachteile für die Belegschaft feststellbar sind, beschließt die Einigungsstelle einen Sozialplan, soweit es nicht vorher zu einer Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat kommt.
Unter einer betrieblichen Übung versteht man die regelmäßige Wiederholung bestimmter, gleichförmiger Verhaltensweisen des Arbeitgebers, die bei den Arbeitnehmern das Vertrauen entstehen lassen, dass ihnen eine erteilte Vergünstigung auf Dauer gewährt werden soll.
Bei jährlich gewährten Zuwendungen – wie beispielsweise dem Weihnachtsgeld – geht die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung grundsätzlich davon aus, dass die dreimalige, gleichförmige und vorbehaltslose Leistung ausreichend ist, um den Arbeitgeber zur Wiederholung zu verpflichten. Auf einen Verpflichtungswillen des Arbeitgebers kommt es dabei nicht an. Maßgeblich ist allein, wie die Arbeitnehmer das Verhalten des Arbeitgebers nach Treu und Glauben und unter Berücksichtigung sämtlicher Begleitumstände verstehen durften. Eine betriebliche Übung kann allerdings nur dann entstehen, wenn es an einer anderen Rechtsgrundlage für die Leistung fehlt. Erbringt der Arbeitgeber die Leistung beispielsweise auf Grund einer Betriebsvereinbarung, ist für eine betriebliche Übung kein Raum mehr.
Möchte der Arbeitgeber die Bindungswirkung einer betrieblichen Übung für die Zukunft ausschließen, so muss er ausdrücklich einen entsprechenden Vorbehalt erklären. Dies kann durch Formulierungen wie „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht” geschehen.
Zur Beendigung einer betrieblichen Übung kommt lediglich eine entsprechende ausdrückliche vertragliche Vereinbarung oder eine Änderungskündigung in Betracht. Seine frühere Rechtsprechung, nach der eine betriebliche Übung durch eine gegenläufige betriebliche Übung aufgehoben werden konnte, hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 18. März 2009 aufgegeben.
Der Einsatz von Betriebsärzten ist in Deutschland durch das „Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ geregelt. Arbeitgeber haben danach Betriebsärzte zu bestellen, wenn ihr Einsatz im Betrieb „erforderlich“ ist. Die Erfordernis richtet sich nach der Betriebsart und den für die Arbeitnehmer damit einhergehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren, der Zahl und der Zusammensetzung der Belegschaft – dabei spielen auch die Altersstruktur oder die Anzahl behinderter Arbeitnehmer eine Rolle – sowie der Betriebsorganisation.
In der Ausgestaltung der Zusammenarbeit ist der Arbeitgeber frei. Er kann einen Betriebsarzt als Arbeitnehmer einstellen, ihn freiberuflich verpflichten oder sich eines überbetrieblichen Dienstes von Betriebsärzten bedienen.
Der Betriebsarzt soll den Arbeitgeber in allen Fragen des Gesundheitsschutzes unterstützen. Dabei stehen vier Tätigkeitsschwerpunkte im Vordergrund. Es ist Aufgabe des Betriebsarztes,
- den Arbeitgeber zu beraten – beispielsweise bei der Planung und Unterhaltung von Betriebsanlagen oder sanitären Einrichtungen, bei der Auswahl von Körperschutzmitteln, bei Fragen des Arbeitsrhythmus und der Arbeitszeit oder bei der Wiedereingliederung behinderter Arbeitnehmer.
- die Arbeitnehmer zu beraten und arbeitsmedizinisch zu untersuchen, etwa im Rahmen einer Eignungsuntersuchung.
- die Durchführung des Gesundheitsschutzes zu beobachten. Dazu muss der Betriebsarzt den Betrieb regelmäßig begehen und Vorschläge zur Behebung festgestellter Mängel unterbreiten.
- darauf hinzuwirken, dass alle im Betrieb Beschäftigten sich den Anforderungen von Arbeitsschutz und Unfallverhütung entsprechend verhalten.
Selbstverständlich haben auch Betriebsärzte die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht zu beachten. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Arbeitnehmers darf dem Arbeitgeber grundsätzlich keine Mitteilung über Untersuchungsergebnisse gemacht werden. Eine pauschale Einwilligung im Arbeitsvertrag ist nicht ausreichend. Eine Verletzung der ärztlichen Schweigepflicht kann allerdings unter den strengen Voraussetzungen des so genannten „übergesetzlichen Notstandes“ gerechtfertigt sein, wenn Gesundheit oder Leben Dritter konkret gefährdet sind. Denkbar wäre dies etwa bei einer Sehschwäche, die zur Fahruntauglichkeit eines Berufskraftfahrers führt.
Gründung, Wahlvorstand und allgemeine Informationen zum Ablauf einer Betriebsratswahl
Ein gutes Betriebsklima und die Einbindung der Mitarbeiter in Unternehmensentscheidungen haben heutzutage viele Unternehmen auf ihre Fahnen geschrieben. Besonders junge Start-ups experimentieren mit „maßgeschneiderten“ Modellen der Mitarbeitervertretung. Echte Mitbestimmung mit den rechtlichen Möglichkeiten, die das deutsche Arbeitsrecht Beschäftigten gewährt, bietet aber nur ein Betriebsrat. Ein Betriebsrat sichert daher Mitbestimmungsrechte. Im Folgenden erfahren Sie, was man tun muss, um einen Betriebsrat zu gründen, und was Sie beachten sollten.
Hat der Betrieb genügend wahlberechtigte Mitarbeiter?
Ein Betrieb ist „betriebsratsfähig“, wenn mindestens fünf wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigt sind. Wahlberechtigt sind dabei alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Neben Vollzeitkräften sind auch Aushilfen, geringfügig Beschäftigte und Teilzeitkräfte gleichermaßen zu berücksichtigen. Sogar Leiharbeitnehmer sind wahlberechtigt, wenn ihr geplanter Einsatz im Betrieb mindestens drei Monate dauert. Ausgenommen sind leitende Angestellte.
Wer startet die Initiative?
Ist die zahlenmäßige Voraussetzung gegeben, müssen sich bei der erstmaligen Gründung eines Betriebsrates mindestens drei Arbeitnehmer über die Gründung des Betriebsrats einig sein. Diese Initiatoren berufen dann eine Betriebsversammlung ein, zu der alle wahlberechtigten Arbeitnehmer eingeladen werden. Wenn es eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft gibt, kann auch diese zur Betriebsversammlung einladen. Wichtig ist, dass alle Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, die Einladung zur Kenntnis zu nehmen. Aus ihr muss außerdem die Tagesordnung hervorgehen, nämlich die Gründung eines Betriebsrats und die Bestellung des Wahlvorstands.
Wie wird der der Wahlvorstand gebildet?
Die Arbeitnehmer wählen in der Betriebsversammlung einen Wahlvorstand, der wiederum aus mindestens drei Arbeitnehmern bestehen muss. Für diese Wahl gibt es keine besonderen Formvorschriften, das heißt, sie muss weder geheim noch schriftlich erfolgen. Im zweiten Wahldurchgang wird dann der/die Vorsitzende gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der auf der Betriebsversammlung anwesenden Arbeitnehmer auf sich vereint. Bei Bedarf kann der Wahlvorstand auch erweitert werden, es muss aber immer eine ungerade Zahl von Arbeitnehmern im Wahlvorstand vertreten sein.
Wie verläuft die Betriebsratswahl?
Nach seiner Wahl organisiert der Wahlvorstand die Durchführung der Betriebsratswahl. Zunächst muss das „richtige“ Wahlverfahren gefunden werden. Dies richtet sich nach der Betriebsgröße. In Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmern ist im normalen Verfahren zu wählen, in Betrieben mit 5 bis 50 Arbeitnehmern ist im vereinfachten Verfahren zu wählen. Betriebe zwischen 51 und 100 Arbeitnehmern haben die Wahl zwischen beiden Verfahren.
Ist das richtige Wahlverfahren gefunden, beginnt die eigentliche Arbeit. Im normalen Wahlverfahren muss der Wahlvorstand nun zunächst eine Wählerliste aller im Betrieb wahlberechtigten Arbeitnehmer aufstellen und zwar getrennt nach Geschlechtern. Die notwendigen Informationen hierzu erhält er vom Arbeitgeber. Die Wählerliste wird dann gemeinsam mit der Wahlordnung im Betrieb ausgelegt.
Spätestens sechs Wochen vor dem ersten Wahltag muss der Wahlvorstand das Wahlausschreiben erlassen. Damit ist die Wahl eingeleitet. Innerhalb der dann folgenden zwei Wochen muss der Wahlvorstand Einsprüche gegen die Wählerliste bearbeiten, die Wählerliste aktuell halten und die Vorschlagsliste für die Kandidaten zur Wahl entgegennehmen und prüfen. Als gültig anerkannte Vorschlagslisten müssen dann durch den Wahlvorstand veröffentlicht werden.
Im vereinfachten Wahlverfahren sind vor allem die Zeitabläufe verkürzt. Es gelten aber die gleichen Grundsätze, die für das normale Wahlverfahren gelten. Es muss also auch hier zunächst ein Wahlvorstand mit drei wahlberechtigten Arbeitnehmern in einer Betriebsversammlung gewählt werden. Der Wahlvorstand erstellt dann zunächst die Wählerliste. Einsprüche gegen diese können dann innerhalb einer verkürzten Frist von drei Tagen erhoben werden. Wahlvorschläge können bei dem Wahlvorstand bis zu einer Woche vor der Wahlversammlung eingereicht werden. Liegen Mängel hinsichtlich der eingereichten Wahlvorschläge vor, muss der Wahlvorstand eine Nachfrist von bis zu drei Tagen gewähren.
Die Wahl selbst findet im vereinfachten Wahlverfahren dann in einer Wahlversammlung statt. Hierzu müssen alle wahlberechtigten Arbeitnehmer eingeladen werden. In der Wahlversammlung werden die gültigen Wahlvorschläge bekannt gegeben. Hierauf folgt die schriftliche Abgabe der Wahlstimmen. Die Auszählung der Stimmen schließt sich unmittelbar an die Stimmabgabe an. Sobald die Stimmen ausgezählt sind, wird das Wahlergebnis unmittelbar darauf in der Versammlung bekannt gegeben.
Wie kommt die Vorschlagsliste zustande?
Alle wahlberechtigten Arbeitnehmer und im Betrieb vertretene Gewerkschaften können Wahlvorschläge einreichen. Dazu werden auf den einzelnen Listen die jeweiligen Bewerber fortlaufend nummeriert aufgeführt. Wählbar sind grundsätzlich alle Wahlberechtigten, die sechs Monate dem Betrieb angehören. Jeder Wahlvorschlag muss dabei eine ausreichende Zahl von Stützunterschriften der wahlberechtigten Arbeitnehmer erhalten. Jeder zur Wahl vorgeschlagene Arbeitnehmer darf nur auf einer Vorschlagsliste geführt werden. Wer einen Vorschlag einreicht, muss darauf achten, dass die schriftliche Zustimmung der einzelnen Kandidaten im Vorfeld erteilt wurde. Sie ist immer bei der Liste zu halten.
Der Wahltag – und was kommt danach?
Ist das Wahlverfahren ordnungsgemäß durchgeführt, können alle Arbeitnehmer, die auf der Wählerliste stehen, ihre Stimme auf einer Vorschlagsliste abgeben. Für ortsabwesende Wahlberechtigte besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Die Abstimmung erfolgt schriftlich auf Wahlzetteln und geheim.
Unverzüglich nach Abschluss der Wahl werden die Stimmen dann öffentlich ausgezählt. Der Wahlvorstand gibt das Ergebnis bekannt und informiert die Gewählten. Über die Wahl ist eine Niederschrift zu fertigen. Der neu gewählte Betriebsrat muss dann innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Wahlvorstand zur konstituierenden Sitzung zusammentreten.
Wieviele Mitglieder der Betriebsrat hat, hängt von der Anzahl der wahlberechtigten Arbeitnehmer ab. Es muss aber immer eine ungerade Zahl von Betriebsräten vertreten sein. Laut Betriebsverfassungsgesetz besteht der Betriebsrat zum Beispiel in Betrieben mit 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person und bei 21 bis 50 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus 3 Mitgliedern. Die genaue Zahl der Betriebsratsmitglieder für Ihren Betrieb können Sie dieser Tabelle entnehmen.
Wann wird normalerweise gewählt?
Die erstmalige Wahl in Betrieben ohne Betriebsrat kann grundsätzlich jederzeit gestartet werden. Ist der Betriebsrat ordnungsgemäß gewählt, muss die nächste Wahl im regelmäßigen Turnus erfolgen. Gewählt wird dann alle vier Jahre (2018, 2022, 2026 usw.), in einem festgelegten Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 30. April, sodass sich die erste Legislaturperiode verkürzen kann.
Gut zu wissen
Haben sich die Arbeitnehmer zur Gründung eines Betriebsrates entschieden, kann der Arbeitgeber das nicht verhindern. Er macht sich sogar strafbar, wenn er versucht, die Wahl zu verhindern.
Arbeitnehmer müssen auch keine Angst vor „Repressalien“ des Arbeitgebers haben: Nicht nur der gewählte Betriebsrat hat einen besonderen Kündigungsschutz, der noch ein Jahr nach Mandatsbeendigung nachwirkt. Auch die Initiatoren der Betriebsversammlung haben bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses grundsätzlich einen besonderen Kündigungsschutz.
Außerdem sollte sich der neu eingesetzte Wahlvorstand gleich zu Beginn schulen lassen. Denn auf den Wahlvorstand kommen einige Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl zu. Der Gesetzgeber hat zahlreiche Formvorschriften hierzu erlassen, ohne deren Kenntnis die Gefahr besteht, dass die Wahl unwirksam oder sogar nichtig ist.
Der Arbeitgeber hat auch die Kosten für die Wahl und die Schulung des künftigen Betriebsrates zu tragen.
Der Bildungsurlaub dient in allen Bundesländern der politischen und beruflichen Arbeitnehmerweiterbildung. Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnisse sechs Monate bestanden haben. Auch Auszubildende erwerben diesen Anspruch. Bundesweit beträgt die Dauer des Anspruchs auf Bildungsurlaub mindestens fünf Tage im Kalenderjahr. Die einzelnen Ausgestaltungen sind den Ländern selbst überlassen.
In Hessen ist der Bildungsurlaub im hessischen Gesetz über den Anspruch auf Bildungsurlaub geregelt. Demnach erhöht sich der Anspruchsumfang von fünf Arbeitstagen auf sechs, wenn regelmäßig an nicht nur fünf, sondern sechs Tagen die Woche gearbeitet wird. Bei einem Teilzeitarbeitsverhältnis verringert sich der Anspruch auf Bildungsurlaub entsprechend der Verteilung auf die einzelnen Wochentage.
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitnehmer bezahlt von der Arbeit freizustellen, sofern ihm der Arbeitnehmer mindestens sechs Wochen vor Beginn der gewünschten Freistellung die Dauer und den Zeitpunkt des Bildungsurlaubs schriftlich mitteilt. Bei den Seminaren muss es sich um anerkannte Bildungsveranstaltungen handelt. Ist dies gewährleistet, kann jeder Arbeitnehmer frei entscheiden, welche Bildungsurlaubsveranstaltung er wahrnehmen möchte. Das kann ein Sprachkurs sein ebenso wie eine Computerschulung. Die Fortbildung muss nicht in direktem Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen. Einzig bei Festlegung der zeitlichen Lage sind die betrieblichen Belange zu berücksichtigen.
Nimmt der Arbeitnehmer den ihm zustehenden Bildungsurlaub nicht in Anspruch, wird er auf das nächste Kalenderjahr übertragen. Voraussetzung ist allerdings, dass bis spätestens 31.12. die Übertragung schriftlich beim Arbeitgeber beantragt wird.
Übrigens hat der Betriebsrat nach § 87 Abs. 1 Nr. 5 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht, wenn es um die Festlegung von Bildungsurlaub oder um die grundsätzliche Inanspruchnahme des Bildungsurlaubs im Betrieb geht. Bei Unstimmigkeiten über die Gewährung und die Festlegung des Zeitpunktes kann die Einigungsstelle angerufen werden.
Die Pflichten, die ein Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses zu erfüllen hat, ergeben sich in erster Linie aus dem Arbeitsvertrag. Im Arbeitsvertrag sind diese jedoch meistens nur allgemein festgeschrieben. Als Direktionsrecht oder Weisungsrecht wird das Recht des Arbeitgebers bezeichnet, die im Arbeitsvertrag nur generalisierend umschriebenen Leistungspflichten einseitig näher auszugestalten und durch Weisungen zu konkretisieren.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage des Direktionsrechts ist neben dem Arbeitsvertrag, den Bestimmungen einer etwaigen Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrags oder sonstigen gesetzlichen Regelungen die Vorschrift des § 106 Gewerbeordnung (GewO).
Inhalt des Direktionsrechts
Nach § 106 GewO kann der Arbeitgeber, soweit keine der genannten höherrangigen Regelungen eingreift, Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung sowie die Ordnung und das Verhalten der Arbeitnehmer im Betrieb nach billigem Ermessen näher bestimmen. Unterhält der Arbeitgeber etwa weitere Betriebe an anderen Standorten, so wäre eine örtliche Versetzung des Arbeitnehmers bei fehlender Regelung zum Arbeitsort im Arbeitsvertrag grundsätzlich möglich.
Grenzen des Direktionsrechts
Seine Grenzen findet das Direktionsrecht des Arbeitgebers in den gesetzlichen sowie den kollektiv- und einzelarbeitsvertraglichen Vorschriften.
Das Direktionsrecht darf nur nach billigem Ermessen im Sinn des § 315 BGB ausgeübt werden. Eine Leistungsbestimmung entspricht billigem Ermessen, wenn die wesentlichen Umstände des Falles abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt worden sind (BAG 23.09.2004 – Az. 6 AZR 567/03). Im Falle der oben erwähnten örtlichen Versetzung wäre folglich zu prüfen, ob diese auch zumutbar ist. Entscheidend sind hier der Wohnort und die Fahrzeit des Arbeitnehmers zum Arbeitsplatz.
Weisungen innerhalb des Direktionsrechts
Weisungen, die vom Direktionsrecht des Arbeitgebers gedeckt sind, hat der Arbeitnehmer Folge zu leisten. Das Nichtbeachten oder die Weigerung des Arbeitnehmers kann den Arbeitgeber nach vorheriger Abmahnung grundsätzlich zu einer verhaltensbedingten, ordentlichen Kündigung berechtigen.
Weisungen außerhalb des Direktionsrechts
Die Befolgung einer individual- oder kollektivrechtlich unzulässigen Weisung kann der Arbeitnehmer hingegen verweigern. Diese Weisungen kann der Arbeitgeber nur mit einer Änderungskündigung durchsetzen. So ist beispielsweise eine Versetzung auf einen minder qualifizierten Arbeitsplatz vom Direktionsrecht nicht gedeckt und ohne Änderungskündigung nicht möglich.
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sieht das Betriebsverfassungsgesetz in § 76 vor, dass in Angelegenheiten der erzwingbaren Mitbestimmung die Einigungsstelle entscheidet. Es handelt sich dabei vor allem um soziale Angelegenheiten wie Arbeitszeitfragen, Urlaubsregelungen oder betriebliche Lohngestaltung wie sie in § 87 des Betriebsverfassungsgesetzes geregelt sind. In abgestufter Weise findet sich die erzwingbare Mitbestimmung auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Bei Betriebsänderungen im Sinne von § 111 des Betriebsverfassungsgesetzes kann der Streit über den Interessenausgleich der Einigungsstelle vorgelegt werden. Entscheidungsbefugt ist die Einigungsstelle auch hinsichtlich des Sozialplans, der den Nachteilsausgleich betrifft.
Nur ausnahmsweise hat die Einigungsstelle Rechtsfragen zu entscheiden, etwa bei Streit über den Umfang der Unterrichtung des Wirtschaftsausschusses (§ 109 des Betriebsverfassungsgesetzes).
Die Einigungsstelle ist paritätisch besetzt. Sie besteht aus einer gleichen Anzahl von Beisitzern des Arbeitgebers und des Betriebsrats und einem neutralen Vorsitzenden, zumeist einem Arbeitsrichter. Das Bundesarbeitsgericht geht von einer Regelbesetzung von zwei Beisitzern je Betriebspartner aus. Erfahrungsgemäß bestehen Einigungsstellen aber jeweils aus drei Beisitzern, von denen zumeist einer nicht aus dem Unternehmen kommt (beispielsweise ein Rechtsanwalt oder ein Gewerkschaftssekretär).
Die Einigungsstelle entscheidet durch Spruch, der die Wirkung einer Betriebsvereinbarung hat und vom Arbeitgeber nach § 77 Absatz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes durchgeführt werden muss. Die Abstimmung findet in zwei Schritten statt. Am ersten Abstimmungsgang nimmt der Vorsitzende nicht teil. Kommt hier keine Mehrheit zustande, entscheidet die Einigungsstelle im zweiten Abstimmungsgang mit der Stimme des Vorsitzenden. Die Beisitzer der Einigungsstelle sind an Weisungen und Aufträge nicht gebunden, verhalten sich allerdings gleichwohl im Einklang mit ihrem Lager – Unternehmen oder Belegschaft.
Bei Streit über deren Besetzung wird die Einigungsstelle in einem vereinfachten Eilverfahren gerichtlich eingesetzt (§ 98 des Arbeitsgerichtsgesetzes). Eine Bestellung unterbleibt nur, wenn das Gericht die offensichtliche Unzuständigkeit der Einigungsstelle feststellt. Der Spruch der Einigungsstelle ist auf Rechts- und Ermessensfehler überprüfbar. Ermessensfehler können aber nur binnen zwei Wochen nach Zustellung des Spruchs gerichtlich geltend gemacht werden.
Wenn ein Arbeitgeber ein bestimmtes Verhalten des Arbeitnehmers nicht weiter hinnehmen will, hat er zwei verschiedene Möglichkeiten, diesen an seine arbeitsvertraglichen Verpflichtungen zu erinnern. Mit einer Abmahnung macht er deutlich, dass arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen, wenn der Mitarbeiter sein Verhalten nicht entsprechend verändert. Neben dem Ausspruch einer Abmahnung kann der Arbeitgeber aber auch zu einem weniger aggressiven Mittel greifen, nämlich der Ermahnung. Diese kann mündlich oder schriftlich erfolgen.
Ein Arbeitnehmer, der eine Ermahnung erhält, muss sich bewusst sein, dass durch die Ermahnung selbst zwar noch keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen drohen. Normalerweise ist diese jedoch die Vorstufe zur Abmahnung. Sie wird in aller Regel auch in die Personalakte genommen und kann sich daher negativ auf die berufliche Karriere auswirken. Ein Arbeitnehmer sollte daher eine Ermahnung ernst nehmen und gesteigert auf die Einhaltung seiner vertraglichen Pflichten achten.
Falsche Vorwürfe sollte sich ein Arbeitnehmer jedoch nicht gefallen lassen und unverzüglich eine Gegendarstellung erstellen. Ferner kann er sich mit einer Beschwerde an den Betriebsrat wenden. Wenn durch die Ermahnung sogar Persönlichkeitsrechte verletzt werden, kann auch gerichtlich die Entfernung der Ermahnung aus der Personalakte verlangt werden.
Was haben die Allianz, Deichmann, Vapiano, Conrad Electronic und BASF gemeinsam? Sie firmieren als Societas Europaea (SE), als sogenannte Europäische Gesellschaft. Die Europäische Gesellschaft ist eine im Europarecht verankerte Form der Aktiengesellschaft. Bereits seit 2004 besteht für Unternehmen mit internationalem Bezug in Europa die Möglichkeit als SE zu firmieren.
I. Rechtliche Grundlagen für die SE sind sowohl im EU-Recht, als auch in nationalem Recht zu finden.
Vorrangig kommt die EU-Verordnung über das Statut der SE, Nr. 2157/2001 vom 08.10.2001: ABIEG Nr. L 294 vom 10.11.2001 zur Anwendung. Ergänzung finden diese Gesetzesgrundlagen durch das nationale Gesetz zur Einführung einer SE (SEEG). Dieses besteht aus dem SE-Ausführungsgesetz (SEAG) und dem SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), es setzt zusätzlich die Vorgaben der EU-Richtlinie über die Rechte der Arbeitnehmer der SE, Nr. 2001/86/EG vom 08.10.2001: ABIEG Nr. L 294 vom 10.11.2001, in unser nationales Recht um.
Daneben bleiben für alle nicht ausdrücklich geregelten Situationen die allgemeinen Vorschriften des Aktiengesetzbuchs (AktG) und des Handelsgesetzbuches (HGB) anwendbar.
II. Gründungszeitpunkt der Europäischen Gesellschaft
Mit in Kraft treten des deutschen Einführungsgesetzes (SEEG) am 29.12.2004 ist eine SE Gründung auch im deutschen Wirtschaftsraum möglich. Sofern die Hauptverwaltung in Deutschland ansässig ist, ist der Sitz der SE in Deutschland und sie wird – wie andere Gesellschaftsformen auch - in das Handelsregister eingetragen., wodurch sie ihre Rechtsfähigkeit erlangt.
III. Gründungsvoraussetzungen
Anders als eine nationale Aktiengesellschaft kann eine Societas Europaea nicht durch natürliche Personen, sondern nur durch juristische Personen (AG, bestehende SE, GmbHs und sonstige Gesellschaften mit bestimmten Einschränkungen) gegründet werden.
Die Gründungsgesellschaften müssen zum einen ihren satzungsmäßigen Sitz und ihre Hauptverwaltung in der EU haben, andererseits muss sie eine Verbindung zu einem anderen oder mehren Mitgliedstaaten aufweisen („europäisches Element”).
Zur Gründung der SE bestehen vier denkbare Szenarien:
- Verschmelzung von nationalen Aktiengesellschaften aus mindestens zwei Mitgliedstaaten
- Umwandlung einer nationalen Aktiengesellschaft mit europäischem Bezug1 in eine Europa AG
- Gründung einer Holdinggesellschaft von Aktiengesellschaften und/oder GmbHs, die in mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten ihren Sitz haben oder seit mindestens zwei Jahren eine dem Recht eines anderen Mitgliedstaates unterliegende Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung haben
- Gründung einer gemeinsamen Tochtergesellschaft von Aktiengesellschaften und/oder GmbHs, die in mindestens zwei verschiedenen Mitgliedstaaten ihren Sitz haben oder seit mindestens zwei Jahren eine dem Recht eines anderen Mitgliedstaates unterliegende Tochtergesellschaft oder Zweigniederlassung haben.
IV. Organe der SE
Die SE besitzt ein Wahlrecht zwischen dem monistischen System (Hauptversammlung, Verwaltungsrat) und dem dualistischen System (Hauptversammlung, Leitungsorgan, Aufsichtsorgan).
Dadurch ist es möglich, daß eine SE mit Sitz in Deutschland eine monistische Struktur wählt. Sofern satzungsmäßig nicht anders bestimmt, besteht ihr Verwaltungsrat aus 3 Mitgliedern. Ab einem Grundkapital von drei Millionen Euro muß der Verwaltungsrat allerdings mit mindestens drei Mitgliedern besetzt werden. Die gesetzliche Festlegung der Höchstzahl diesem Gremium angehöriger Personen ist abhängig vom Grundkapital.2
Im Verwaltungsrat gibt es zumindest einen geschäftsführenden Direktor sowie daneben nicht geschäftsführende Direktoren/Mitglieder. Wird eine mitbestimmte Gesellschaft im monistischen System gegründet, gehören die Arbeitnehmervertreter unmittelbar dem Verwaltungsrat an.
Im dualistischen System muß ab einem Grundkapital von mehr als drei Millionen Euro das Leitungsorgan aus mindestens 2 Personen bestehen. Bei einer nicht mitbestimmten Gesellschaft kann die Satzung vorsehen, daß die Leitung der SE nur durch eine Person vorgenommen wird.
Die Größe des Aufsichtsorgans steht in Abhängigkeit zur Höhe des Grundkapitals. Bei einer mitbestimmten SE setzen sich seine Mitglieder aus Aktionärs- und Arbeitnehmervertretern zusammen.
V. Unternehmerische Mitbestimmung
Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben die Möglichkeit zur Einigung auf ein beliebiges Mitbestimmungsmodell. Zum Zwecke der Verhandlungsführung in diesem Einigungsprozess wird auf Arbeitnehmerseite ein besonderes Verhandlungsgremium gebildet.
Das Verhandlungsgremium folgt in seiner Zusammensetzung dem Umstand, daß es Arbeitnehmer aus verschiedenen Gesellschaften und Mitgliedstaaten vertritt. Die Wahl erfolgt nach einem bestimmten Länderschlüssel in geheimer und unmittelbarer Wahl.
Gewerkschaften haben Vorschlagsrechte. Besteht keine Arbeitnehmervertretung, wählen die Arbeitnehmer direkt. Andernfalls sind Konzern-, Gesamtbetriebsräte und Betriebsräte zur Wahl aufgerufen.
Das Wahlgremium ist auf max. 40 Mitglieder begrenzt. Innerhalb von 10 Wochen nach Verlautbarung der geplanten Gründung durch die Unternehmensleitung muß das Gremium errichtet sein. Seine Entscheidung hat es innerhalb von 6 Monaten zu treffen; eine Fristverlängerung auf 12 Monate ist möglich.
Im Falle eines Scheiterns der vorgenannten Verhandlungen tritt - unter der Prämisse einer in den beteiligten Gesellschaften bestehenden Mitbestimmung sowie der Erfüllung gesetzlich vorgesehener Voraussetzungen - eine Auffangregelung in Kraft. Dies dient der Wahrung bereits vor der SE-Gründung existierender Mitbestimmungsrechte auf Arbeitnehmerseite.
Sie gilt ab dem Zeitpunkt der Eintragung und führt in Hinsicht auf die Gründungsform zu unterschiedlichen Ergebnissen.
Im Fall der Umwandlung bleibt die vorher bestehende Mitbestimmung in der nationalen Aktiengesellschaft nach § 34 Abs. 1 Ziff. a SEBG bestehen.
Bei der Verschmelzung kann es zu einer Übertragung des höchsten Mitbestimmungsstandards einer beteiligten Gesellschaft auf die SE kommen.
Voraussetzung ist, daß vor Eintragung mindestens in einer der beteiligten Gesellschaften Mitbestimmungsrechte bestehen und diese sich auch auf 25% der Gesamtarbeitnehmer erstreckt. Dies gilt auch, wenn für weniger als 25% der Gesamtarbeitnehmer Mitbestimmungsrechte bestehen, das Verhandlungsgremium aber einen entsprechenden Beschluss nach § 34 Abs. 1 Ziff. b. SEBG faßt.
Die Auffangregelung bei Holding-SE oder Tochter-SE funktioniert nach dem gleichen Prinzip, jedoch mit höheren Schwellenwerten. Hier müssen 50% der Gesamtarbeitnehmer entsprechende Mitbestimmungsrechte haben.
1 AG muß mindestens über einen Zeitraum von 2 Jahren eine Tochtergesellschaft in einem anderen europäischen Mitgliedstaat haben. Eine Sitzverlegung anläßlich der Umwandlung ist unzulässig.
2 Vgl. § 23 SEAG.
Die Gewerkschaften sind die Interessenvertreter der Arbeitnehmerschaft (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Auszubildende). Sie sind unabhängig von Staat, Kirchen und den Parteien und setzen sich für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder ein. Ins Bewusstsein der Öffentlichkeit treten sie vor allem immer dann, wenn sie zur Durchsetzung ihrer Forderung nach höherem Lohn streiken oder durch Arbeitskampfmaßnahmen Betriebsstilllegungen oder Ausgliederungen verhindern wollen. Die jüngsten Auseinandersetzungen bei AEG und Telekom sind jedem geläufig.
Gewerkschaften treten gemeinsam mit Arbeitgeberverbänden als „Gesetzgeber” im Betrieb auf. In § 2 Abs. 1 des Tarifvertragsgesetzes (TVG) wird erwähnt, dass Gewerkschaften Tarifvertragsparteien sind – neben einzelnen Arbeitgebern und Arbeitgeberverbänden. Das heißt, sie regeln anstelle des staatlichen Parlaments die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder normativ. Dahinter steht die Idee, dass Gewerkschaften – anders als der einzelne Arbeitnehmer – in der Lage sind, gerechtere Bedingungen durchzusetzen.
Das Bundesarbeitgericht hat in ständiger Rechtsprechung folgende Voraussetzungen für die Anerkennung als Gewerkschaft aufgestellt:
- Gewerkschaften müssen frei gebildet sein.
- Sie müssen vom sozialen Gegenspieler unabhängig sein. Eine Organisation mit Mitgliedern aus dem Kreis der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber würde dieses Kriterium nicht erfüllen.
- Darüber hinaus muss die Gewerkschaft gegenüber dem Arbeitgeberverband in der Lage sein, ihre Forderungen durchzusetzen. Hierzu bedarf es einer gewissen Durchsetzungskraft, damit Mitliederstärke und Leistungsfähigkeit der Organisation.
Unbestritten erfüllen die im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengefassten Organisationen diese Anforderungen. Sie sind in der Lage, Tarifverträge zu Gunsten ihrer Mitglieder durchzusetzen, gegebenenfalls mit Arbeitskampfmaßnahmen. Ihre soziale Mächtigkeit, die für die Gewerkschaftseigenschaft grundlegend ist, kann nicht bestritten werden. Im DGB als Dachverband sind acht Einzelgewerkschaften organisiert:
- IG Bauen-Agrar-Umwelt
- IG Bergbau, Chemie, Energie
- EVG - Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
- IG Metall
- Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gastätten
- Gewerkschaft der Polizei
- ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Die DGB-Gewerkschaften sind bundesweit für alle Bereiche der deutschen Wirtschaft zuständig und nach dem sogenannten Industrieverbandsprinzip aufgebaut. Das heißt, dass Arbeitnehmer aus einzelnen Industriebereichen sämtlich von einer DGB-Gewerkschaft repräsentiert werden. Beispiel: In der Automobilindustrie werden alle Beschäftigten vom Bandarbeiter bis zum Bereichsleiter in die IG Metall aufgenommen.
Nach ihrem Selbstverständnis sind die DGB Gewerkschaften politisch unabhängig. In ihren Reihen finden sich nicht nur Mitglieder der SPD, sondern solche aus allen anderen demokratischen Parteien, insbesondere der CDU/CSU und der Linkspartei.
Der DGB und seine Einzelgewerkschaften reagieren sensibel auf das Entstehen neuer Arbeitnehmervereinigungen, die den Abschluss von Tarifverträgen zum Ziel haben. Sie haben seit Jahren mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen, fürchten Konkurrenzorganisationen und stellen deren Gewerkschaftseigenschaft in Frage. Stetes Argument gegen die Konkurrenz: Den Kleineren fehle Durchsetzungsfähigkeit und organisatorische Leistungsfähigkeit. So bestritten per Gerichtsverfahren etwa die IG Metall die Gewerkschaftseigenschaft der Christlichen Gewerkschaft Metall (CGM), die vor allem im Osten Deutschlands Tarifverträge schließt; ver.di bekämpfte Organisationen wie die Unabhängige Flugbegleiter-Organisation (UFO), die das Kabinenpersonal größerer Fluggesellschaften, insbesondere der Deutschen Lufthansa, organisiert.
Das Bundesarbeitsgericht hat in zwei Entscheidungen den CGM und die UFO als Gewerkschaften anerkannt. Die Durchsetzungsfähigkeit des CGM sei durch eine Reihe von Tarifverträgen belegt. Der CGM sei also in der Lage, die Rechte seiner Mitglieder zu vertreten. Bei UFO sei entscheidend, dass Arbeitnehmer in Schlüsselpositionen organisiert seien. Diese könnten in Auseinandersetzungen Druck ausüben, weil sie nicht so schnell ersetzbar seien.1)
Ganz unplausibel klingen die Argumente des Bundesarbeitsgerichts nicht. Übersteigerte Anforderungen an die Tariffähigkeit würden zu einer Aushöhlung der Koalitionsfreiheit nach Art. 9 Abs. 3 GG führen. Der „Markt” für tariffähige Arbeitnehmervereinigungen würde dann sehr schnell geschlossen sein und es könnte praktisch keine neue Organisation mehr als Gewerkschaft auftreten. Die DGB-Gewerkschaften müssen sich daher darauf einstellen, mit Argumenten für bessere Lösungen zu werben, ohne mit Hilfe der Gerichte kleinere Organisationen aus dem Ringen um Tarifverträge verdrängen zu können.
Neben dem DGB-Gewerkschaften gibt es weitere Arbeitnehmerorganisationen, die sich als Gewerkschaften definieren. Teilweise sind sie in Dachverbänden zusammengefasst. Dies sind im Wesentlichen:
- Der Deutsche Bankangestellten Verband (DBV) – Gewerkschaft der Finanzdienstleister, eine aus der sozialliberalen Tradition der Hirsch-Dunkerschen Gewerkvereine entstandenen Organisation, die derzeit vermehrt Erfolge im Bankgewerbe vermelden kann.
- Der Marburger Bund, der durch den Ärztestreik öffentliches Aufsehen erregte.
- Der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB) mit seinen Organisationen, insbesondere der Christlichen Gewerkschaft Metall und dem DHV, einer Angestelltenorganisation.
- Der Deutsche Beamtenbund (DBB), dem Einzelorganisationen wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sowie die im Postbereich tätige Kommunikationsgewerkschaft DPV angehören.
1) BAG, 14.12.2004, Aktenzeichen 1 ABR 51/03, AP TVG § 2 Tariffähigkeit Nr. 1; BAG 28.03.2006, Aktenzeichen 1 ABR 51/04, AP TVG § 2 Tariffähigkeit Nr. 4.
Zur Lösung von Arbeitsverträgen bestehen verschiedene Möglichkeiten. Die rechtlichen Grundlagen werden im Folgenden kurz erläutert:
1. Die ordentliche Kündigung
Der häufigste Fall einer Kündigung ist die fristgemäße, ordentliche Kündigung. In diesem Fall handelt es sich um die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Ablauf der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist. Die Arbeitgeberseite muss dem Mitarbeiter schriftlich mitteilen, dass das Arbeitsverhältnis gekündigt werden soll. Hier muss die Kündigung von der Arbeitgeberseite richtig unterschrieben werden und dem Mitarbeiter zugehen. Fehler in der Vertretungsberechtigung, fehlende Schriftform wie zum Beispiel Fax oder Mail wie auch die Nichtaushändigung des Kündigungsschreibens können zu einer Unwirksamkeit der Kündigung führen.
Auf die Unwirksamkeit einer Kündigung kann sich der Arbeitnehmer jedoch nur berufen, wenn er binnen drei Wochen nach Zugang der Kündigung Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht erhebt. Eine solche Kündigungsschutzklage zielt darauf, festzustellen, dass das bestehende Arbeitsverhältnis durch die ausgesprochene Kündigung nicht beendet wurde.
Die Arbeitgeberseite muss im Prozess nachweisen, dass es Gründe für eine ordentliche Kündigung gibt, die der Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers im Betrieb entgegenstehen. Ausgenommen von der Begründungspflicht ist sie jedoch, wenn es sich um einen Kleinbetrieb handelt, also weniger als zehn Arbeitnehmer im Betrieb beschäftigt sind oder die Wartezeit nach dem Kündigungsschutzgesetz noch nicht abgelaufen ist. Diese Wartezeit entspricht der landläufig als Probezeit bezeichneten sechsmonatigen Frist.
Sind die Voraussetzungen gegeben, muss der Arbeitgeber sich im Prozess für die Kündigung rechtfertigen. Hier steht er allein in der Darlegungs- und Beweislast, die Kündigung muss folglich hieb- und stichfest sein. Als Begründung kommen personenbedingte, verhaltensbedingte oder betriebsbedingte Gründe in Betracht.
Bei der personenbedingten Kündigung muss der Arbeitgeber nachweisen, dass der betreffende Arbeitnehmer seine Arbeit (nicht mehr) erfüllen kann, da ihm bestimmte Eigenschaften fehlen. Der klassische Fall ist hier die krankheitsbedingte Kündigung. Entgegen der Meinung vieler Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind hier nicht die Fehlzeiten in der Vergangenheit entscheidend, sondern ausschließlich eine „Zukunftsprognose”. Eklatante Fehlzeiten des Arbeitnehmers können zwar auch auf zukünftigen Ausfall des Arbeitnehmers und daraus entstehende, dem Arbeitgeber nicht zumutbare wirtschaftliche Belastungen schließen lassen. Jedoch trägt die Arbeitgeberseite das Risiko, dass dem Arbeitnehmer im Prozess der Nachweis gelingt, dass der Großteil seiner Krankheitszeiten auf nunmehr abgeschlossenen oder ausgeheilten Krankheiten beruht, welches eine negative Gesundheitsprognose verhindert.
Die verhaltensbedingte Kündigung betrifft steuerbares Verhalten, also die Arbeitspflichtverletzung. Hier kann es jedoch je nach Schwere des Vorwurfs notwendig sein, dass die Arbeitgeberseite vor Ausspruch einer Kündigung eine Abmahnung ausspricht. Eine Abmahnung besteht aus der Formulierung des vorwerfbaren Verhaltens sowie der Androhung, dass im Wiederholungsfalle der Arbeitnehmer arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten muss.
Bei der betriebsbedingten Kündigung muss die Arbeitgeberseite nachweisen, dass der konkrete Arbeitsplatz weggefallen ist, es keine freien Stellen im Unternehmen gibt und eine Sozialauswahl zu Ungunsten des Arbeitnehmers ausfällt. Innerhalb der Sozialauswahl wird die Schutzwürdigkeit des Betroffenen anhand der Kriterien Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und Unterhaltspflichten mit den vergleichbaren Arbeitnehmern abgewogen. Erst dann, wenn die Arbeitgeberseite vertretbar zu dem Ergebnis kommen darf, dass der betroffene Mitarbeiter der am wenigsten Schutzbedürftige ist, ist die Kündigung wirksam.
2. Die außerordentliche Kündigung
Außerordentlich – das heißt fristlos – darf die Arbeitgeberseite kündigen, wenn ihr es aus wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann, das Arbeitsverhältnis bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist fortzusetzen. Dies bejaht die Rechtsprechung bei gravierenden Verstößen gegen die Arbeitspflicht, wie beispielsweise Arbeitsverweigerung, aber auch bei dem Verdacht oder dem Nachweis einer Straftat. In diesem Fall muss die Arbeitgeberseite binnen zwei Wochen nach Kenntnis des Vorwurfs die Kündigung ausgesprochen haben, ansonsten ist es ihr verwehrt, eine außerordentliche Kündigung auszusprechen. Die ordentliche Kündigung aus demselben Vorwurf bleibt aber auch nach dem Versäumen dieser Frist möglich.
3. Die außerordentliche, hilfsweise ordentliche Kündigung
Eine solche spricht der Arbeitgeber immer aus, wenn er zwar außerordentlich kündigen will, die Möglichkeit des Unterliegens jedoch mit einkalkuliert. In diesem Falle macht er deutlich, dass er jedenfalls das Arbeitsverhältnis durch die ordentliche Kündigung beenden möchte. Geht ein Arbeitnehmer im Wege der Kündigungsschutzklage erfolgreich gegen die außerordentliche Kündigung vor, kann es also sein, dass das Arbeitsverhältnis nichtsdestotrotz ordentlich endet. Das Arbeitsgericht prüft dann faktisch zwei Kündigungen.
Die Frist zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses kann sich aus dem Gesetz, aus einem anwendbaren Tarifvertrag oder aus dem Arbeitsvertrag ergeben. Bei einer Kündigung ist daher darauf zu achten, ob gesetzliche Kündigungsfristen, tarifvertragliche Kündigungsfristen oder arbeitsvertragliche Regelungen zur Anwendung kommen.
Gesetzliche Kündigungsfristen
Die gesetzlichen Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen regelt § 622 BGB. Hier gelten jeweils unterschiedliche Fristen:
Grundkündigungsfrist
§ 622 Abs. 1 BGB sieht eine Grundkündigungsfrist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats vor. Es ist zu beachten, dass vier Wochen (=28 Tage) nicht mit einem Monat gleichzusetzen sind. Die Frist beginnt an dem Tag, der dem Zugang des Kündigungsschreibens folgt.
Verlängerte Kündigungsfrist für Arbeitgeber
Abhängig von der Beschäftigungsdauer verlängert sich die Kündigungsfrist. § 622 Abs. 2 S.1 BGB sieht folgende Fristen vor:
- ab zwei Jahren ein Monat zum Ende des Kalendermonats,
- ab fünf Jahren zwei Monate zum Ende des Kalendermonats,
- ab acht Jahren drei Monate zum Ende des Kalendermonats,
- ab zehn Jahren vier Monate zum Ende des Kalendermonats,
- ab zwölf Jahren fünf Monate zum Ende des Kalendermonats,
- ab fünfzehn Jahren sechs Monate zum Ende des Kalendermonats,
- ab zwanzig Jahren sieben Monate zum Ende des Kalendermonats.
Auch für die Berechnung der Dauer des Arbeitsverhältnisses kommt es auf den Zeitpunkt des Zugangs und nicht auf den Ausspruch der Kündigung an.
Die von § 622 Abs. 2 S.2 BGB getroffene Regelung, nach der bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer Zeiten vor Vollendung des 25. Lebensjahres nicht berücksichtigt werden, ist wegen des Verstoßes gegen das Verbot der Altersdiskriminierung unwirksam und damit unbeachtlich.
Gesetzliche Sonderregelungen
Während der Probezeit ergeben sich Abweichungen. Das Arbeitsverhältnis kann gemäß § 622 Abs. 3 BGB während der Probezeit, die maximal sechs Monate betragen darf, mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. Eine Kündigung innerhalb der Probezeit liegt vor, wenn die Kündigung innerhalb der Probezeit zugeht. Endet die zweiwöchige Frist nach Ablauf der Probezeit, so ist diese unwirksam.
Weitere Ausnahmen zu den oben genannten Fristvorschriften regelt das Gesetz in den §§ 22 BBiG, 113 Abs. 1 S. 3 InsO, 21 Abs. 4 S. 1 BEEG und 86 SGB IX.
Tarifvertragliche Kündigungsfristen
Gemäß § 622 Abs. 3 BGB kann durch Tarifvertrag von den gesetzlichen Kündigungsfristen abgewichen werden. Die Abweichungen sind auch wirksam, wenn sie zu Lasten des Arbeitnehmers gehen, also kürzer als die gesetzlichen Regelungen sind. Tarifvertragliche Fristen sind nur dann anwendbar, wenn eine beidseitige Tarifbindung vorliegt, oder der Tarifvertrag arbeitsvertraglich in Bezug genommen wird.
Arbeitsvertragliche Regelungen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber können im Arbeitsvertrag längere als die im Gesetz geregelten Kündigungsfristen vereinbaren. Dann finden selbstverständlich die vertraglichen Kündigungsfristen Anwendung.
Grundsätzlich gilt jedoch, dass für die Kündigung durch den Arbeitnehmer keine längere Frist vereinbart werden darf als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.
Eine kürzere Frist als die Grundkündigungsfrist aus § 622 Abs. 1 BGB kann gemäß § 622 Abs. 5 BGB nur dann wirksam vereinbart werden, wenn der Arbeitnehmer als Aushilfe und nicht länger als drei Monate beschäftigt wird, oder es sich um einen Kleinbetrieb mit weniger als zwanzig Arbeitnehmern handelt. Im Kleinbetrieb darf die Kündigungsfrist vier Wochen jedoch nicht unterschreiten.
Besonderheit des befristeten Arbeitsvertrags
Ein befristeter Vertrag kann nur dann ordentlich gekündigt werden, wenn dies im Arbeitsvertrag oder in einem anwendbaren Tarifvertrag ausdrücklich geregelt ist (§15 Abs. 3 TzBfG).
Mithilfe einer Kündigungsschutzklage hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich gegen eine arbeitgeberseitige Kündigung zur Wehr zu setzen. Ziel der Kündigungsschutzklage ist die gerichtliche Feststellung, dass das bestehende Arbeitsverhältnis durch die ausgesprochene Kündigung nicht aufgelöst worden ist.
Der Arbeitnehmer kann die Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht entweder selbst erheben oder sich hierbei durch einen Anwalt vertreten lassen. Zu beachten ist jedoch, dass die Erhebung der Kündigungsschutzklage fristgebunden ist. Auf die Unwirksamkeit der Kündigung kann sich der Arbeitnehmer mithin nur dann berufen, wenn er binnen drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigungserklärung eine Kündigungsschutzklage erhebt, § 4 Satz 1 KSchG. Diese Drei-Wochen-Frist gilt für jede Art von Kündigung (ordentliche und außerordentliche Kündigung, Kündigung während der Probezeit, Verdachtskündigung etc.) und unabhängig davon, ob das Kündigungsschutzgesetz im Übrigen anwendbar ist. Sollte diese Frist bereits verstrichen sein, so gilt die Kündigung von Gesetzes wegen als von Anfang an rechtswirksam, § 7 KSchG, sofern nicht ausnahmsweise eine verspätete Klage unter den engen Voraussetzungen des § 5 KSchG zugelassen wird.
Sofern das Kündigungsschutzgesetz in persönlicher und sachlicher Hinsicht anwendbar ist, bedarf die ordentliche Kündigung zu ihrer Wirksamkeit einer sozialen Rechtfertigung. Betroffene genießen in diesem Fall den prozessual wertvollen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Auf persönlicher Ebene ist hierfür erforderlich, dass das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, § 1 Abs.1 KSchG. Der sachliche Anwendungsbereich ist regelmäßig eröffnet, wenn in dem Betrieb des Arbeitgebers mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind, § 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG. Als Kündigungsgründe kommen in diesem Fall personen-, verhaltens- oder betriebsbedingte Gründe in Betracht, welche der Arbeitgeber darlegen und beweisen muss.
Sobald die Kündigungsschutzklage eingereicht und dem Klagegegner zugestellt worden ist, wird zunächst ein Termin für eine Güteverhandlung festgelegt, die dazu dienen soll, eine gütliche Einigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Im Rahmen dieses sogenannten Gütetermins haben die Parteien die Möglichkeit, einen Vergleich zu schließen, der beispielsweise auch Regelungen über die Zahlung einer Abfindungssumme und über den Inhalt eines Arbeitszeugnisses enthalten kann. Maßgeblich ist hierbei nicht zuletzt das Verhandlungsgeschick des Arbeitnehmers beziehungsweise seines Rechtsbeistandes.
Kommt eine gütliche Einigung nicht zustande, so bestimmt das Gericht einen neuen Termin zur mündlichen Verhandlung, den sogenannten Kammertermin. Sofern keine einvernehmliche Lösung erzielt werden kann, endet der Rechtsstreit regelmäßig mit der Verkündung eines Urteils, welches die Feststellung enthält, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung (nicht) aufgelöst ist.
Leitende Angestellte nehmen für das Unternehmen oder einen Betrieb des Unternehmens typische Unternehmerfunktionen wahr. Hierdurch unterscheiden sie sich von den übrigen Arbeitnehmern. Aus ihrer exponierten Stellung und der besonderen Nähe zum Arbeitgeber ergeben sich erhöhte Treuepflichten. An personen- und verhaltensbedingte Kündigungen sind geringe Anforderungen zu stellen. Die Vergütung der leitenden Angestellten wird frei ausgehandelt. Gehaltstarifverträge gelten in aller Regel nicht für die leitenden Angestellten.
Der Begriff des leitenden Angestellten taucht in zahlreichen arbeitsrechtlichen Gesetzen auf (vgl. § 5 Abs. 3 BetrVG, § 14 KSchG, § 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG, § 22 Abs. 2 Nr. 2 ArbGG, § 1 SprAuG, § 3 MitbestG). Es kann nicht von einem einheitlichen Begriff des leitenden Angestellten ausgegangen werden. Stets ist der Begriff im Kontext der jeweiligen Gesetzesbestimmung zu interpretieren, in der er verwandt wird.
Leitende Angestellte im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes
Die Definition des leitenden Angestellten im Betriebsverfassungsgesetz stellt zwingendes Recht dar: Leitender Angestellter ist derjenige, der nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder Betrieb eines der in § 5 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 genannten Merkmale erfüllt. Hierfür ist es nicht notwendig, dass sich die Aufgabenbeschreibung aus dem Arbeitsvertrag ergibt. Eine mündliche Vereinbarung über die Position reicht zur Statusbegründung aus. Entscheidend ist, ob die tatsächliche Tätigkeit die eines leitenden Angestellten im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG ist. Eine ausdrückliche Vereinbarung im Arbeitsvertrag ist daher auch nicht ausreichend, solange die vom Angestellten tatsächlich wahrgenommen Aufgaben nicht die eines leitenden Angestellten sind.
Selbständige Einstellung und Entlassung von Beschäftigten
Nach § 5 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG ist leitender Angestellter, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder Betrieb zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist. Eine solche Befugnis liegt nicht vor, wenn der Betreffende bei einer Einstellungs- oder Entlassungsentscheidung an die Zustimmung übergeordneter Stellen gebunden ist. Die Berechtigung muss sich dabei – im Unterschied zu § 14 Abs. 2 KSchG – sowohl auf die Einstellung als auch auf die Entlassung beziehen. Es reicht nicht aus, dass sich die Befugnis nur auf einzelne Arbeitnehmer bezieht.
Generalvollmacht oder Prokura
Nach § 5 Abs. 3 Nr. 2 BetrVG ist leitender Angestellter derjenige, dem Generalvollmacht oder Prokura verliehen wurde. Die Prokura darf dabei im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend sein; so genannte Titularprokuristen sind beispielsweise keine leitenden Angestellten. Gesetzlich zulässige Beschränkungen der Prokura – Gesamtprokura (§ 48 Abs. 2 HGB) oder Niederlassungsprokura (§ 50 Abs. 3 HGB) – stehen der Einordnung als leitender Angestellter nicht entgegen.
Unternehmerische Leitungsaufgaben
Leitender Angestellter im Sinne von § 5 Abs. 3 Nr. 3 BetrVG ist derjenige, der „sonstige Aufgaben“ wahrnimmt, die für Bestand und Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind. Diese „sonstigen Aufgaben“ können nur unternehmerische Leitungsaufgaben sein. In Betracht kommen Aufgaben wirtschaftlicher, kaufmännischer, technischer, organisatorischer, personeller oder wissenschaftlicher Art. Entscheidend ist, dass der Angestellte die unternehmerischen Teilaufgaben in erheblichem Umfang wahrnimmt. Die Erfüllung solcher Aufgaben hat besondere Erfahrungen und Kenntnisse vorauszusetzen, die auch durch längere praktische Tätigkeit erworben sein können. Der leitende Angestellte muss Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen treffen oder diese doch maßgeblich beeinflussen können. Nicht erforderlich ist, dass alle anfallenden Entscheidungen selbst getroffen werden. Auch Stabsangestellte, deren Vorschläge Entscheidungen anderer vorbereiten, können daher leitende Angestellte sein, wenn ihre Tätigkeit nicht nur einen ausführenden Charakter hat.
Entscheidungshilfe bei Zweifelsfällen
§ 5 Abs. 4 BetrVG bietet eine Entscheidungshilfe für Zweifelsfälle. So kann ausschlaggebend sein, dass ein Angestellter aus Anlass der letzten Betriebsrats-, Sprecherausschuss- oder Aufsichtsratswahl den leitenden Angestellten zugeordnet war. In Zweifelsfällen kann weiter eine rechtskräftige Entscheidung des Arbeitsgerichts entscheiden (§ 5 Abs. 4 Nr. 1 BetrVG). Auch kann erheblich sein, dass ein Angestellter in einer Leitungsebene mit überwiegend leitenden Angestellten tätig ist (§ 5 Abs. 4 Nr. 2 BetrVG). Erhält ein Angestellter ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt, das für leitende Angestellte im Unternehmen üblicherweise gezahlt wird, kann dies den Status des leitenden Angestellten indizieren (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 BetrVG). Ist das regelmäßige Jahresentgelt dreimal so hoch wie die Bezugsgröße nach § 18 SGB IV (Bezugsgröße für die Sozialversicherung), spricht dies ebenfalls für den Status des leitenden Angestellten (§ 5 Abs. 4 Nr. 4 BetrVG).
Keine Vertretung durch den Betriebsrat und Teilnahme an den Betriebsratswahlen
Leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG werden nicht vom Betriebsrat vertreten. Vor einer Kündigung ist der Betriebsrat daher nicht anzuhören. Der Betriebsrat kann daher einer ordentlichen Kündigung auch nicht mit der Konsequenz widersprechen, dass dem Arbeitnehmer ein Weiterbeschäftigungsanspruch nach § 102 Abs. 5 BetrVG zukommt. Dies kann zu prozesstaktischen Nachteilen im Kündigungsstreit führen.
Entsprechend § 5 Abs. 3 BetrVG sollen Angestellte, die typische Unternehmensaufgaben mit eigenem Entscheidungsspielraum wahrnehmen, nicht gleichzeitig den Betriebsrat wählen oder zum Betriebsrat gewählt werden.
Leitende Angestellte im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes: Auflösung des Arbeitsverhältnisses jederzeit möglich
Leitende Angestellte genießen – auch wenn sie nicht vom Betriebsrat vertreten werden – den allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz (vgl. § 14 Abs. 1 KSchG). Gemäß § 14 Abs. 2 KSchG ergibt sich für leitende Angestellte aber eine Besonderheit: In Abweichung zu § 9 Abs. 1 KSchG muss der Arbeitgeber einen Antrag auf gerichtliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht begründen. Das bedeutet: Auch wenn der Arbeitgeber einem leitenden Angestellten ungerechtfertigt gekündigt hat, kann er sich ohne Weiteres mit einen Auflösungsantrag von ihm trennen. Der leitende Angestellte kann daher den Bestand seines Arbeitsverhältnisses nicht effektiv verteidigen und die Weiterbeschäftigung durchsetzen. Das Gericht diktiert dabei die Abfindungshöhe. Es ist anders als bei freien Aufhebungsverhandlungen an Vorgaben zur Höhe der Abfindung gebunden (vgl. § 10 KSchG).
Dabei definiert § 14 Abs. 2 KSchG den Begriff des leitenden Angestellten eigenständig. Leitender Angestellter im Sinne des § 14 Abs. 2 KSchG ist derjenige, der eine einem Geschäftsführer vergleichbare Stellung einnimmt. Diese Stellung wird durch Ausübung unternehmerischer Führungsverantwortung gekennzeichnet.
Allerdings muss der Angestellte nach § 14 Abs. 2 KSchG weiter zur selbstständigen Einstellung oder Entlassung berechtigt sein. (Damit ist § 14 Abs. 2 KSchG weiter gefasst als 5 Abs. 3 Nr. 1 BetrVG, der Einstellungs- und Entlassungsbefugnis kumulativ voraussetzt.) Die Berechtigung muss sich dabei auf eine erhebliche Anzahl von Beschäftigten beziehen. Von einer Berechtigung zur selbstständigen Einstellung oder Entlassung kann nicht gesprochen werden, wenn die personelle Maßnahme von der Zustimmung einer anderen Person abhängig ist.
Grundsätzlich steht es jedem Arbeitnehmer frei, seine Freizeit nach Belieben zu gestalten. Hierzu gehört auch das Recht, einer Nebentätigkeit nachzugehen. Unter Nebentätigkeit versteht man im Allgemeinen, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft außerhalb des Hauptarbeitsverhältnisses einsetzt. Dies kann bei demselben oder einen anderem Arbeitgeber, entgeltlich oder ehrenamtlich sein. Allerdings muss der Arbeitnehmer die Nebentätigkeit seinem Arbeitgeber zumindest mitteilen und – je nach Formulierung im Arbeitsvertrag – auch dessen Genehmigung einholen. Warum ist das so?
Das Recht, einer Nebentätigkeit nachzugehen, kann in bestimmten Situationen mit den Interessen des (Haupt-)Arbeitgebers kollidieren. Etwa dann, wenn die Nebentätigkeit zu faktischen Beeinträchtigungen des (Haupt-)Arbeitsverhältnisses führt und den Arbeitnehmer an der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Arbeitspflicht hindert. In diesem Fall kann der Hauptarbeitgeber die Nebentätigkeit ganz oder teilweise untersagen. Bei einem öffentlichen Arbeitgeber wird dies für Teilzeitbeschäftigte in der Regel erst dann vermutet, wenn die Nebentätigkeit 20 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit überschreitet (LAG Rheinland-Pfalz, 18.08.2005, Az. 4 Sa 553/05).
Einschränkungen der Nebentätigkeit
Die Nebentätigkeit darf auch nicht dazu führen, dass die gesetzlich zulässige Höchstgrenze von acht bzw. im Ausnahmefall zehn Stunden täglich überschritten wird. Das Gleiche gilt für andere gesetzliche Vorgaben, wie z.B. die Lenkzeiten eines Kraftfahrers. Die Zeiten werden dann arbeitgeberübergreifend zusammengerechnet. Weiterhin muss die Ruhezeit zwischen der Beendigung der abendlichen Nebentätigkeit und dem Beginn der täglichen Haupttätigkeit mindestens 11 Stunden betragen. Der Hauptarbeitgeber muss die Einhaltung des Arbeitschutzgesetzes (ArbZG) überwachen und die Nebentätigkeit bei Überschreitung einschränken.
Während des Urlaubs im Hauptarbeitsverhältnis darf der Arbeitnehmer keine Erwerbstätigkeiten ausüben, die dem Erholungszweck widersprechen. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass jeder für sich am besten weiß, was Erholung für ihn bedeutet. Die Einschränkungsmöglichkeiten des Arbeitgebers sind daher gering. Hat dieser die Nebentätigkeit genehmigt, besteht für den Arbeitnehmer keine Verpflichtung, seinen Urlaub für beide Arbeitsverhältnisse zeitgleich zu nehmen.
Konkurrenzausschluss
Neben diesen arbeitsorganisatorischen Beeinträchtigungen kann die Ausübung einer Nebentätigkeit auch zu einer wettbewerbsbedingten Kollision mit dem Hauptarbeitsverhältnis führen. Auch wenn es hierzu keine explizite Vereinbarung im Arbeitsvertrag gibt, ist Konkurrenztätigkeit untersagt (§ 60 HGB). Der Arbeitnehmer darf also im Geschäftsfeld des Arbeitgebers weder ein Handelsgewerbe betreiben, noch für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen. Allerdings rechtfertigen Gründe des unmittelbaren Wettbewerbs nur dann die Untersagung einer Nebentätigkeit, wenn aus der Stellung des Arbeitnehmers oder der Art der Tätigkeit eine direkte Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen des Arbeitgebers droht. Das Austragen von Zeitungen durch eine teilzeitbeschäftigte Sortiererin in einem Briefverteilzentrum rechtfertigt hingegen kein Verbot der Nebentätigkeit (BAG NZA 2010,693). Denn dabei handelt es sich um eine bloße Hilfstätigkeit ohne Wettbewerbsbezug.
Politik und Wirtschaft diskutieren schon länger kontrovers über ein flächendeckendes Mindestlohnniveau. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Trotzdem müssen sich Arbeitnehmer nicht mit einem Hungerlohn abspeisen lassen. Die Bezahlung unterliegt nicht der Willkür des Chefs. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sichert schon jetzt ein Recht auf „Mindestlohn”.
Arbeitnehmer können sich auf Sittenwidrigkeit oder Wucher berufen und eine faire Vergütung für die von ihnen erbrachte Arbeitsleistung durchsetzen, wenn der Arbeitgeber einen deutlich zu niedrigen Lohn im Arbeitsvertrag festschreibt.
Die rechtliche Grundlage für die Unwirksamkeitserklärung einer zu niedrigen Gehaltsabrede – dem sogenannten Lohnwucher – findet sich in den Absätzen 1 und 2 des § 138 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Eine zu niedrige Gehaltsvereinbarung kann sittenwidrig sein (§ 138 Abs. 1 BGB). Eine Nichtigkeit wegen Wuchers ist nach § 138 Abs. 2 BGB dann anzunehmen, wenn ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht und der Wucherer (Arbeitgeber) dieses Missverhältnis bewusst, etwa unter Ausnutzung einer Zwangslage oder der Unerfahrenheit des Vertragspartners (Arbeitnehmer) verabredet hat. Eine zu geringe Vergütung wegen Wuchers kann sogar strafbar sein.
Wann ein solches auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bestehen soll, ist im Einzelfall oft schwierig abzuschätzen. Eine gewisse Klarheit hat das Bundesarbeitsgericht mit seinem Urteil vom 22. April 2009 (Az.: 5 AZR 436/08) mit Bezug auf den üblichen Tariflohn hergestellt. Nach dieser Entscheidung liegt ein auffälliges Missverhältnis vor, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal 2/3 eines in der betreffenden Branche und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten Tariflohns erreicht. Das Missverhältnis ist dann auffällig, so führt das Gericht aus, wenn es einem Kundigen ohne Weiteres ins Auge springt. Für die Praxis greifbar wird diese Rechtsprechung mit dem Verweis auf die 2/3-Grenze des üblichen Tariflohns. Wird der übliche Tariflohn in einem Verhältnis von mehr als 1/3 unterschritten, liegt eine erhebliche, nicht mehr hinnehmbare Abweichung vor, die nur bei einer Sonderberechtigung des Arbeitgebers nicht als wucherisch einzuordnen ist.
Mit diesen Vorgaben schränkt die Rechtsprechung nicht die negative Konnektionsfreiheit der Arbeitsvertragsparteien ein, also die freie Entscheidung, ob man sich einem Tarifvertrag unterwerfen will oder nicht. Die einschlägigen Tarifverträge werden lediglich rechtstatsächlich als Vergleichsmaßstab zur Bestimmung der üblichen und angemessenen Vergütungshöhe herangezogen. Den Arbeitsvertragsparteien bleibt es weiterhin freigestellt, nicht in die Gewerkschaft oder den Arbeitgeberverband einzutreten. Sie müssen auch keinen Tarifvertrag in das Arbeitsverhältnis direkt mit einzubeziehen.
Die Folge eines Verstoßes gegen § 138 BGB ist, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entgegen der vertraglichen Abrede die übliche Vergütung zu zahlen hat. Allerdings ist die Bestimmung der Vergleichsgruppen bei der Frage der üblichen Vergütung meist nicht konfliktfrei. Da der „wucherische” Arbeitgeber die Nichtigkeit der von ihm vorgeschlagenen Vergütungshöhe mit großer Wahrscheinlichkeit nicht akzeptieren wird, werden Arbeitnehmer den ihnen tatsächlich zustehenden „Mindestlohn” gerichtlich einklagen müssen.
Das Recht, sich einer Ausbeutung zu widersetzen, hat ein Arbeitnehmer bereits heute, wenn er den Mut zur Gegenwehr aufbringt. Schwierig wird es für den einzelnen jedoch besonders in Kleinbetrieben (weniger als 10 Mitarbeiter). Hier findet das Kündigungsschutzgesetz regelmäßig keine Anwendung. Ein Arbeitnehmer kann dann zwar in der Auseinandersetzung um die Vergütungsfrage die Oberhand behalten, ob das Arbeitsverhältnis im Streitfalle jedoch Bestand hat, ist stark zu bezweifeln.
Der Begriff „Outsourcing” ist eine Kurzform des betriebswirtschaftlichen Terminus „Outside Resource Using”. Gemeint ist die Auslagerung einzelner Aufgabenbereiche entweder innerhalb eines Unternehmens oder einer Konzernstruktur (internes Outsourcing) oder ihrer Vergabe an externe Anbieter (externes Outsourcing). Klassisch und prägnant umschrieben wird die hinter dem Begriff stehende Entscheidung durch das Begriffspaar „Make or buy” – selber machen oder kaufen.
Outsourcing ist kein neues Phänomen. Gründe für eine Auslagerung von Aufgabenbereichen sind vielfältig. Häufig werden aus wirtschaftlichem Druck teure oder selbst nicht effizient auszuführende Tätigkeiten an speziellere Dienstleister abgegeben. Ziel ist die Konzentration auf das Kerngeschäft. Auf diese Weise können Zeit und Kosten gespart, Qualität gesteigert und Risiken verlagert werden. Der Bezug von Fremdleistungen und die Anzahl von Outsourcingverträgen haben in den letzten Jahren stark zugenommen.
In rechtlicher Hinsicht liegt dem Outsourcing oft ein Betriebsübergang im Sinne von § 613a BGB zu Grunde. Ein Betriebsübergang setzt voraus, dass die wirtschaftliche Einheit des übergehenden Betriebes gewahrt bleibt. Das ist der Fall, wenn Arbeitnehmer und materielle Arbeitsmittel auf den neuen Arbeitgeber übergehen und ein Know How-Transfer stattfindet.
Die Konsequenzen für die Beschäftigten
Handelt es sich beim Outsourcing um einen Betriebsübergang im Sinn von § 613a BGB wird der Übernehmer kraft Gesetz neuer Arbeitgeber der dem übergehenden Betrieb zugeordneten Arbeitnehmer. Bestehen beim Erwerber keine betriebsverfassungsrechtlichen Vereinbarungen, so gelten die bisherigen Rechte aus den Betriebsvereinbarungen individualrechtlich weiter (§ 613a Abs. 1 Satz 2 BGB).
Veräußerer und Erwerber haben die betroffenen Arbeitnehmer über die Einzelheiten des Betriebsübergangs zu informieren. Der Arbeitnehmer kann dem Übergang seines Arbeitsverhältnisses innerhalb eines Monats widersprechen. Er bleibt dann Arbeitnehmer des Altarbeitgebers. Allerdings riskiert er bei dem ehemaligen Arbeitgeber eine betriebsbedingte Kündigung wegen des Wegfalls des Arbeitsplatzes.
Die Rechte des Betriebsrats
Outsourcing stellt in der Regel eine Betriebsänderung im Sinne von § 111 BetrVG dar. Grundsatz ist, dass dem Betriebsrat in Zusammenhang mit Outsourcing verschiedene Informations- und Mitbestimmungsrechte zustehen. Betriebsrat und Arbeitgeber sollen versuchen, einen Interessenausgleich herbeizuführen. Der Betriebsrat hat das Recht, den Prozess durch eigene Vorschläge konstruktiv zu begleiten und Sachverständige mit Kontrolle und Erarbeitung von Alternativen zu beauftragen. Die Möglichkeiten, Outsourcingmaßnahmen zu stoppen oder empfindlich zu verzögern, sind jedoch insgesamt sehr gering. Bei der Entwicklung von Alternativstrategien ist aber eine bessere Kosten/Nutzenrechnung unter Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze zu erreichen.
§ 80 Abs. 2 BetrVG stellt die Generalklausel des Informationsrechts dar. Er öffnet dem Betriebsrat die Möglichkeit, Auskünfte einzufordern, die der Betriebsrat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zur Begleitung eines Outsourcings benötigt. Die Unterrichtung durch den Arbeitgeber hat rechtzeitig und umfassend zu erfolgen. Rechtzeitig ist die Beteiligung des Betriebsrates dann, wenn sich der Arbeitgeber bereits verschiedene Lösungsmöglichkeiten überlegt hat und nunmehr vor der Auswahl der optimalen Lösung steht. Eine umfassende Auskunftserteilung setzt voraus, dass der Betriebsrat alle verfügbaren Informationen des Arbeitgebers erhält, um seine Entscheidung ordnungsgemäß treffen zu können. Dazu kann auch die Nennung von Betriebsgeheimnissen sowie die Weitergabe persönlicher Daten gehören.
Auf der Grundlage der so erlangten Informationen kann der Betriebsrat die ihm nach dem Betriebsverfassungsgesetz zustehenden, weiteren Rechte ausüben. Diese beziehen sich etwa auf die Gestaltung von Arbeitsplatz und Umgebung, auf die Sicherung der Beschäftigungsverhältnisse und insbesondere auch auf die Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen, z.B. bei Kündigungen oder Versetzungen im Rahmen eines Outsourcings.
Essentiell ist die wirtschaftliche Mitbestimmung des Betriebsrats, wenn die Outsourcing-Maßnahme unter die Pflicht zur Erstellung eines Interessenausgleichs oder Sozialplans fällt, um entstehende wirtschaftliche Nachteile auszugleichen oder zu mildern. Können sich Betriebsrat und Arbeitgeber dabei nicht einigen, kann die Einigungsstelle angerufen werden.
Die Personalakte ist eine Sammlung von Unterlagen, die sich auf die Person des Arbeitnehmers in Verbindung mit seinem Arbeitsverhältnis beziehen, und die wesentliche Grundlage der Personalverwaltung. Die Personalakte soll ein vollständiges, wahrheitsgemäßes und sorgfältiges Bild über den Werdegang eines Arbeitnehmers während des Beschäftigungsverhältnisses geben.
Der Arbeitgeber ist jedoch nicht verpflichtet, Personalakten zu führen. Eine Weitergabe der Unterlagen an Dritte, z.B. an andere Arbeitgeber, ist ohne Einverständnis des Arbeitnehmers unzulässig. Die Personalakte kann in Papierform oder elektronisch geführt werden. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses trifft den Arbeitgeber über die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften hinaus keine Pflicht zur Aufbewahrung der Personalakte.
Zum Inhalte der Personalakte gehören:
- Personenstand
- Berufliche Entwicklung
- Fähigkeiten
- Leistungen
- Anerkennungen
- Beurteilungen
- Arbeitsunfälle
- Krankheitszeiten
- Urlaubsvertretungen
- Unterlagen über Weiterbildungsmaßnahmen
- Abmahnungen
- Betriebsbußen
Der Arbeitnehmer hat ein Einsichtsrecht
Da die Personalakte sich auf die Person und das Verhalten des Arbeitnehmers bezieht, besteht ein allgemeiner Anspruch auf Einsichtnahme gemäß § 83 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG). Das Einsichtsrecht berechtigt den Arbeitnehmer zudem, Notizen und Kopien aus der Personalakte auf eigene Kosten zu fertigen. Es kann ohne besonderen Anlass und ohne Nennung eines Grunds geltend gemacht werden. Ein besonderes Interesse des Arbeitnehmers an einer Einsicht seiner Personalakte ist somit nicht erforderlich. Der Arbeitnehmer darf hierzu ein Betriebsratsmitglied seiner Wahl hinzuziehen (§ 83 Abs. 1 Satz 2 BetrVG).
Anspruch auf Gegendarstellung
§ 83 Abs. 2 BetrVG gewährt dem Arbeitnehmer neben dem Einsichtsrecht auch das Recht, eine Gegendarstellung der Personalakte beizufügen. Dadurch erhält der Arbeitnehmer die Möglichkeit, den Inhalt der Personalakte zu ergänzen oder Gegenvorstellungen und Richtigstellungen beifügen zu lassen. Dieses Recht besteht selbst dann, wenn der Arbeitgeber die jeweilige Erklärung für unzutreffend hält oder diese als nicht in die Personalakten gehörend ansieht.
Anspruch auf Entfernung von Unterlagen
Darüber hinaus steht dem Arbeitnehmer ein Anspruch auf Entfernung aus der Personalakte zu – beispielsweise die einer rechtswidrigen Abmahnung. Ein solcher Anspruch folgt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers (§§ 1004, 242 BGB analog). Er wird vom Bundesarbeitsgericht in ständiger Rechtsprechung bei Äußerungen anerkannt, die unzutreffende Tatsachenbehauptungen enthalten und den Arbeitnehmer in seiner Rechtsstellung und in seinem beruflichen Fortkommen beeinträchtigen können.
Bei der Vereinbarung von Rufbereitschaft ist der Arbeitnehmer verpflichtet, auf Abruf die Arbeit aufzunehmen. Die Rechtsprechung ordnet die Rufbereitschaft als „Verpflichtung zur jederzeitigen Erreichbarkeit” ein (vgl. BAG vom 11.07.2006, 9 AZR 519/05). Der Arbeitnehmer ist also gewissen Einschränkungen unterworfen. Er muss für den Arbeitgeber jederzeit erreichbar sein, darf sich aber grundsätzlich an einem Ort seiner Wahl aufhalten.
Seine Erreichbarkeit kann beispielsweise über ein Festnetz-/Mobiltelefon oder einen Piepser gewährleistet werden. Im Rahmen der Rufbereitschaft darf der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht dazu anweisen, in der Nähe seines Arbeitsortes zu bleiben, damit die Anfahrtszeiten minimiert sind. Wird die Ortswahl eingeschränkt, liegt keine Rufbereitschaft, sondern Bereitschaftsdienst vor.
Rufbereitschaft gilt nicht als Arbeitszeit. Erst wenn der Arbeitnehmer während seiner Rufbereitschaft zur Arbeit herangezogen wird, ist die geleistete Arbeitszeit zu vergüten.
Unter Bereitschaftsdienst versteht man dagegen Zeiten, in denen sich ein Arbeitnehmer außerhalb der festgelegten Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber vorgegebenen Stelle innerhalb oder außerhalb des Betriebs aufzuhalten hat, um auf Abruf unverzüglich seine volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen zu können. Im Gegensatz zur Rufbereitschaft zählt ein Bereitschaftsdienst voll zur Arbeitszeit und ist auch vollständig zu vergüten.
Die rechtliche Wertung, dass Rufbereitschaft nur dann zu einer Vergütung führt, wenn die Arbeitsleistung auch abgerufen wird, ist für manche Arbeitnehmer schwer nachvollziehbar, da ihre Freizeitgestaltung doch wesentlichen Einschränkungen unterliegt. So können beispielsweise keine Reisen unternommen werden. Außerdem ist die körperliche Einsatzfähigkeit für einen Arbeitseinsatz (Dauerbeispiel: Alkohol) zu gewährleisten.
Kündigungsschutz für besonders schutzwürdige Arbeitnehmer
Neben dem allgemeinen Kündigungsschutz (§§ 1, 23 Abs. 1 KSchG) existieren spezielle Regelungen, welche besonderen Arbeitnehmergruppen einen sogenannten Sonderkündigungsschutz gewähren. Der Gesetzgeber hat Sonderkündigungsschutzregelungen in unterschiedlicher Intensität etabliert. Sie gewähren den schutzbedürftigen Arbeitnehmern eine weitreichende Absicherung. Diese soll beispielsweise die Funktionsfähigkeit der Betriebsverfassung sicherstellen – wie im Fall des Schutzes der Betriebsratsmitglieder – oder aber grundrechtlich schutzwürdigen Positionen Rechnung tragen – wie bei Müttern und Schwangeren oder auch Schwerbehinderten.
Einen besonderen Kündigungsschutz genießen deshalb beispielsweise Betriebsräte, Bewerber zu Betriebsratswahlen, Wahlvorstände, politische Mandatsträger, Auszubildende, Schwangere oder Schwerbehinderte. Das Gesetz gestaltet diesen Schutz unterschiedlich aus, teilweise kombiniert es verschiedene Schutzmechanismen.
Ausschluss der ordentlichen Kündigung: Betriebsräte und politische Mandatsträger
Für Amtsträger der Betriebsverfassung ist in § 15 Abs. 1 Satz 1 KSchG geregelt, dass die Kündigung unzulässig ist, soweit nicht Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zu einer Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Damit ist letztlich die ordentliche Kündigungsmöglichkeit ausgeschlossen. Dieser Schutz gilt insbesondere für Betriebsratsmitglieder, Mitglieder des des europäischen Betriebsrats sowie Mitglieder der Schwerbehindertenvertretungen. Gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 KSchG gilt Entsprechendes für Wahlbewerber und Mitglieder des Wahlvorstandes.
Unter diesen Regelungsmechanismus fällt auch der Kündigungsschutz gegenüber Mitgliedern der Abgeordneten eines Kreistags in Hessen (§ 28a Abs. 2 Satz 1 HKO) oder auch den Mitgliedern der Gemeindevertretung in Hessen (§ 35a Abs. 2 Satz 1 HGO).
Für die genannten Abgeordneten wie für die ordentlichen Mitglieder der Arbeitnehmervertretungen als auch deren Wahlbewerber und Wahlvorstandsmitglieder sieht das Gesetz zudem einen so genannten nachwirkenden Kündigungsschutz vor, der sich an den Zeitraum nach Amtsbeendigung bzw. Abschluss der Wahl anschließt. Eine Kündigung kann der Arbeitgeber dann ebenfalls lediglich unter den hohen Voraussetzungen des § 626 BGB aussprechen.
Besonderer Schutz auch für Auszubildende und Betriebsbeauftragte
Ein Ausschluss der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit ist zudem für Auszubildende in § 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG geregelt. Danach kann ein Ausbildungsverhältnis im Anschluss an die Probezeit durch den Ausbilder lediglich aus wichtigem Grund gekündigt werden.
Weitere Schutzregelungen, die den Ausschluss der ordentlichen Kündigungsmöglichkeit regeln, finden sich für sogenannte Betriebsbeauftragte. So ist beispielsweise gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1 BImSchG die Kündigung gegenüber einem Immissionsschutzbeauftragten ebenfalls nur dann möglich, wenn Tatsachen vorliegen, die den Betreiber zu einer Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Auch dieser Schutz des Immissionsschutzbeauftragten wird für die Zeit nach seiner Amtsausübung ausgedehnt. So bleibt der Ausspruch der ordentlichen Kündigung für einen Zeitraum von einem Jahr nach der Abberufung weiterhin unzulässig. Entsprechendes gilt etwa für den Störfallbeauftragten nach dem BImSchG sowie den Abfallbeauftragten nach dem KrW-/AbfG.
Kündigung des Arbeitgebers lediglich unter dem Vorbehalt der Zustimmung eines Dritten
Für einzelne Personengruppen sieht das Gesetz einen grundsätzlichen Ausschluss der Kündigungsmöglichkeit im Ganzen vor. Dies gilt etwa im Hinblick auf Schwangere (§ 9 Abs. 1 Satz 1 MuSchG). Auch für Eltern in der Elternzeit ist ein grundsätzlicher Ausschluss der Kündigungsmöglichkeit geregelt worden (§ 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BEEG).
In beiden Fällen ist eine Kündigung jedoch nicht unbedingt ausgeschlossen. Sie steht vielmehr unter einem Zustimmungsvorbehalt. Die gesetzliche Regelung sieht vor, dass mit der Zustimmung der zuständigen Behörde die Kündigung gegenüber Schwangeren oder Wöchnerinnen erklärt werden kann. Hier kann die zuständige Behörde die Zustimmung zur Kündigung erteilen, wenn ein „besonderer Fall“ vorliegt, der nicht mit dem Zustand der Frau während der Schwangerschaft oder der Wöchnerinnenzeit im Zusammenhang steht. Dabei ist es nicht notwendig, dass ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB gegeben ist. Ähnliches gilt für Väter und Mütter in der Elternzeit. Auch hier kann gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 BEEG die Kündigung durch die zuständige Behörde für zulässig erklärt werden, wenn ein „besonderer Fall“ „ausnahmsweise“ gegeben ist.
In ähnlicher Weise ist beispielsweise die Kündigung gegenüber einem Schwerbehinderten oder diesem gleichgestellten Menschen nur eingeschränkt zulässig. Gemäß § 85 SGB IX bedarf die Kündigung gegenüber diesen Arbeitnehmern, sofern das Arbeitsverhältnis sechs Monate ununterbrochen bestanden hat, der Zustimmung des Integrationsamts. Dies gilt gemäß § 91 Abs. 1 SGB IX auch für eine außerordentliche Kündigung im Sinne des § 626 BGB.
Darüber hinaus existieren Sonderkündigungsschutzregelungen, welche die Kündigungsmöglichkeit auf das Vorliegen eines wichtigen Grundes beschränken und dies zusätzlich mit dem Vorbehalt einer Zustimmung durch Dritte kombinieren. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise die Kündigung gegenüber Mitgliedern des Betriebsrats zu nennen. Wie bereits angesprochen sind diese gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 KSchG nur außerordentlich aus wichtigem Grund kündbar. Darüber hinaus hat das Gesetz vorgesehen, dass selbst die außerordentliche Kündigung der Zustimmung des Betriebsrates gemäß § 103 BetrVG bedarf. Ist diese Zustimmung nicht gegeben und auch nicht durch ein Arbeitsgericht ersetzt worden, ist selbst die außerordentliche Kündigung unzulässig.
Bonus, 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld, Gratifikationen
Zur Regelung weiterer Zahlungen neben der laufenden monatlichen Vergütung gibt es eine ganze Reihe von arbeitsvertraglichen Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere in Form von Bonuszahlungen, 13. Monatsgehalt, Gratifikationen und Weihnachtsgeld. Die einzelnen Begriffe sollen hier genauer vorgestellt werden.
Bonus
Die schlichte Formulierung im Arbeitsvertrag, wonach der Arbeitgeber die Zahlung eines Bonus in frei von ihm festzulegender Höhe in Aussicht stellt, ist heutzutage ein nahezu gängiger Arbeitsvertragsinhalt. Der Arbeitnehmer weiß mit dieser Regelung zunächst noch nicht, ob er einen Bonus erhält und für den Fall, dass er einen Bonus erhalten soll, wie hoch der Betrag ausfällt und dieser zur Zahlung fällig wird.
Zumeist dokumentiert der Arbeitgeber die Gewährung einer Bonuszahlung schriftlich. Dabei können sich Fallstricke für die Zukunft ergeben, wenn der Inhalt solcher Schreiben nicht genau formuliert ist. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer ganz eindeutig erklären, welchen Hintergrund die Zahlung hat. Nur wenn er für den Arbeitnehmer unmissverständlich deutlich macht, dass es sich um eine einmalige freiwillige Leistung handelt, die auch bei wiederholter Zahlung keinen Rechtsanspruch für die Zukunft entstehen lässt, vermeidet er das potentielle Entstehen einer betrieblichen Übung.
Zielbonus
Die Anreizfunktion einer zusätzlichen Vergütung kann innerhalb des Arbeitsvertrags oder durch eine zusätzliche Vereinbarung genau dokumentiert werden. Bei der Vereinbarung über einen Zielbonus legen die Parteien für eine Zielperiode gemeinsam bestimmte vom Arbeitnehmer zu erreichende Ziele fest. Werden diese erfüllt, erhält der Arbeitnehmer einen zuvor ebenfalls festgelegten Betrag als zusätzliche Vergütung. Insbesondere bei Führungskräften und leitenden Angestellten werden Zielvereinbarungen angewendet, um eine starke Identifikation der Führungskraft mit Unternehmenszielen zu erreichen.
Wurde eine Zielvereinbarung zwischen den Parteien abgeschlossen, ist diese nicht auf ihre Angemessenheit hin durch das Arbeitsgericht überprüfbar, da sich der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber ja gerade über die Ziele verständigt haben.
Fehlt es an einem Abschluss einer Zielvereinbarung für eine bestimmte Zielperiode soll der Anspruch des Arbeitnehmers auf variable Vergütung nicht grundsätzlich verloren gehen. Vielmehr kommt es darauf an, welche Vertragspartei das Nichtzustandekommen einer Zielvereinbarung zu vertreten hat.
Trifft den Arbeitgeber das Verschulden für den Nichtabschluss, macht er sich gegenüber dem Arbeitnehmer nach Ablauf der Zielperiode schadensersatzpflichtig.
Die Schadenshöhe orientiert sich grundsätzlich an dem maximal zu zahlenden variablen Bonusbetrag. Haben sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer das Nichtzustandekommen einer Zielvereinbarung zu vertreten, ist das Mitverschulden des Arbeitnehmers bei der Schadensberechnung angemessen zu berücksichtigen.
13. Monatsgehalt
In der Regel findet sich in Arbeitsverträgen beispielsweise die Formulierung: „Der Arbeitnehmer erhält zusätzlich ein 13. Monatsgehalt, zahlbar im November.”
In diesem Fall kann der Arbeitgeber die Zahlung des 13. Monatsgehalts nicht mit einem vermeintlichen Freiwilligkeitsvorbehalt verweigern. Ein solcher Freiwilligkeitsvorbehalt müsste eindeutig geregelt sein.
Mit dem vorgenannten Beispiel wird die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers im Kalenderjahr belohnt. Scheidet der Arbeitnehmer vor dem Auszahlungstermin aus, so verbleibt ihm ein Anspruch auf anteilige Auszahlung (pro rata temporis).
Gratifikation, Weihnachtsgeld und Jahressonderzahlungen
Eine Jahressonderzahlung oder eine Weihnachtsgratifikation kann auch die zukünftige Betriebstreue des Arbeitnehmers honorieren. Diese Vereinbarungen können mit Stichtagsregelungen versehen werden. Hierzu wird im Arbeitsvertrag beispielsweise geregelt, dass der Arbeitnehmer am 30.11. eines Kalenderjahres ein Bruttomonatsgehalt erhält, wenn das Arbeitsverhältnis zu diesem Zeitpunkt ungekündigt ist. Bei einer Eigenkündigung des Arbeitnehmers vor dem 30.11. würde er seinen Anspruch verwirken. Gleiches gilt bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber aus verhaltensbedingten Gründen. Bei Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung müsste zumindest der Anspruch bis zum Datum des Ausscheidens aus dem Betrieb anteilig gezahlt werden.
Gängig sind auch Regelungen zu Rückzahlungsverpflichtungen. Solche Rückzahlungsklauseln unterliegen der vollen arbeitsgerichtlichen Überprüfbarkeit. Nur die ausdrückliche und bestimmt formulierte Klausel kann eine wirksame Rückzahlungsverpflichtung des Arbeitnehmers auslösen. Bei Rückzahlungsverpflichtungen liegt der Zweck der Sonderzahlung nicht nur in der Honorierung vergangener Leistungen, sondern dient insbesondere auch der Motivation und dem Erhalt der Betriebstreue des Arbeitnehmers. Die Zulässigkeit der Rückzahlungsverpflichtung hängt von der Höhe der Sonderzahlung und der Bindungsdauer ab.
Mit Sperrzeiten sanktioniert die Bundesagentur für Arbeit versicherungswidriges Verhalten wie das Ablehnen einer angebotenen Beschäftigung oder unzureichende Eigenbemühungen, um einen neuen Job zu finden. Allein im Jahr 2009 hat sie insgesamt 843.000 Sperrzeiten ausgesprochen. Ein häufiger Fall ist die Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe.
Sperrzeit bei Arbeitsaufgabe mindert Anspruch auf Arbeitslosengeld
Wer ohne einen wichtigen Grund sein Beschäftigungsverhältnis im Rahmen einer Aufhebungsvereinbarung löst, riskiert eine Sperrzeit von zwölf Wochen. In dieser Zeit ruht der Anspruch auf Arbeitslosengeld. Bei einem Anspruch auf Bezug von Arbeitslosengeld von 12 Monaten beginnt die Zahlung dann erst nach Ablauf von zwölf Wochen. Nach § 128 SGB III mindert sich wegen Arbeitsaufgabe der Anspruch auf Arbeitslosengeld um die Anzahl von Tagen einer Sperrzeit.
Nur wenn der Arbeitsplatz definitiv entfällt und eine Weiterbeschäftigung an anderer Stelle unmöglich ist, kann von einer Sperrzeit abgesehen werden.
Aufhebungsverträge können die Zahlung von Arbeitslosengeld blockieren
Bei Verhandlungen über einen Aufhebungsvertrag sollte man sich umfassend mit den verbundenen Risiken beschäftigen. Vor allem ist auf die Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist durch den Arbeitgeber zu achten. Oft wird die Aufhebungsvereinbarung durch einen erhöhten Abfindungsbetrag unter gleichzeitiger Verkürzung der einzuhaltenden Kündigungsfrist schmackhaft gemacht. Das kann sich negativ auf den Bezug von Arbeitslosengeld auswirken. Wer wegen der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses eine Abfindung erhalten oder zu beanspruchen hat und das Arbeitsverhältnis ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist beendet, riskiert, dass sein Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht, und zwar vom Ende des Arbeitsverhältnisses an bis zu dem Tag, an dem es bei Einhaltung dieser Frist geendet hätte. Das kann bei langen Kündigungsfristen wirtschaftlich sehr kostspielig sein.
Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass der Verlust des Arbeitsverhältnisses in aller Regel nicht durch die Zahlung einer Abfindung ausgeglichen werden kann. Wer keine Sanktionen in Kauf nehmen will und auf die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit angewiesen ist, sollte daher Angebote auf Beendigung seines Arbeitsverhältnisses genauestens überdenken und möglicherweise keine Aufhebungsvereinbarung abschließen, sondern auf den Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung zuwarten.
Am 01.01.2004 wurden die Transfermaßnahmen und das Transferkurzarbeitergeld in den §§ 216a, 216b des Sozialgesetzbuches III (SGB III) neu geregelt. Ziel der Gesetzesregelung ist es, die Eingliederung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt zu fördern. Das ist nötig, wenn Arbeitnehmern durch eine Betriebsänderung Arbeitslosigkeit droht. Auf die Förderung besteht bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Rechtsanspruch.
Transfermaßnahmen, § 216a SGB III
Als Transfermaßnahmen werden Eingliederungsmaßnahmen gefördert, die der Arbeitgeber mindestens zur Hälfte mitfinanziert. Dabei muss die Maßnahme der Eingliederung von Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt dienen. Die Maßnahme muss ferner organisatorisch und finanziell gesichert sein. Der Arbeitgeber kann solche Transfermaßnahmen nicht selbst durchführen. Vielmehr muss er ein Drittunternehmen, das einen bestimmten Qualitätsstandard gewährleistet, mit der Durchführung betrauen.
Im Rahmen von Transfermaßnahmen sollen Leistungsfähigkeit, Arbeitsmarktchancen und Qualifikationsbedarf der von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitnehmer ermittelt werden (sog. Profiling). Gefördert werden Bewerbungstrainings und die Unterstützung bei der Stellensuche, die Fortsetzung einer Berufsausbildung und Existenzgründungen.
Die Förderung greift nur bei Betriebsänderungen. Es handelt sich dabei um Restrukturierungen, die eine größere Zahl der Betriebsbelegschaft betreffen. Der Begriff der Betriebsänderung wird in § 111 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) definiert. Hierunter fallen Betriebsschließungen,
Standortverlagerungen, Betriebsfusionen oder -spaltungen sowie grundlegende Organisationsänderungen. Ist § 111 BetrVG im Normalfall nur auf Unternehmen mit mehr als 20 regelmäßig Beschäftigten anwendbar, so kommt es für die Förderung von Transfermaßnahmen auf diese Unternehmensgröße nicht an: Förderung erhalten auch Arbeitnehmer in Kleinunternehmen, soweit eine Betriebsänderung geplant ist.
Die Förderung wird als einmaliger Zuschuss gewährt, und zwar bis zu einem Betrag von EUR 2.500,-. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Unternehmen die Maßnahmen mindestens zur Hälfte bezuschusst und sie organisatorisch absichert. Transfermaßnahmen im Sinne von § 216a SGB III werden in den Betriebräumen und während der Arbeitszeit der Betroffenen durchgeführt. Für Transfermaßnahmen hat sich in der Praxis der Begriff der Transferagentur eingebürgert.
Transferkurzarbeitergeld und Transfergesellschaft, § 216b SGB III
Das Transferkurzarbeitergeld dient der Vermeidung von Entlassungen. Von Restrukturierungen betroffene Arbeitnehmer sollen so schnell wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Sie sollen neue Beschäftigungsperspektiven in einem anderen Unternehmen erhalten. Der Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld ist daran geknüpft, dass der Betroffene von einem dauerhaften Arbeitsausfall betroffen ist.
Förderungsvoraussetzung ist die Zusammenfassung der betroffenen Arbeitnehmer in einer betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit. Eine betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit kann auch innerhalb des eigenen Unternehmens gebildet werden. Üblicherweise wird diese Organisationseinheit von einer externen Transfergesellschaft organisiert. Der Übertritt zur Transfergesellschaft erfolgt dann durch Abschluss eines dreiseitigen Vertrages, mit dem das bisherige Beschäftigungsverhältnis aufgelöst und ein neues – befristetes – Arbeitsverhältnis zur Transfergesellschaft begründet wird. Dabei verzichtet der Arbeitnehmer ganz oder teilweise auf die Einhaltung seiner vertraglichen Kündigungsfrist.
Die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses in der Transfergesellschaft können zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber durch Sozialplan oder separate Betriebsvereinbarung geregelt werden. Auch im Tarifvertrag mit einer Gewerkschaft können die Bedingungen vereinbart werden. Zumeist wird den Arbeitnehmern in der Transfergesellschaft ein Nettoverdienst von 80 bis 85 % des zuvor bezogenen Nettoverdienstes garantiert. Der bisherige Arbeitgeber leistet diese Aufzahlung, denn das Transferkurzarbeitergeld beläuft sich normalerweise nur auf 60 % und ausnahmsweise auf 67 % des früheren Nettoverdienstes.
Die Verweildauer in der Transfergesellschaft beträgt maximal zwölf Monate. Während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld ist der Arbeitnehmer verpflichtet, Vermittlungsangebote der Arbeitsverwaltung wahrzunehmen. Oft sehen Transferregelungen vor, dass Arbeitnehmer, die sich aktiv um Beschäftigung bemühen und deshalb vorzeitig aus der Transfergesellschaft ausscheiden, eine Anreizprämie erhalten.
Laut einer aktuellen Auskunft des Bundesarbeitsministerium (Stand 2016) arbeiten 1,7 Millionen Beschäftigte regelmäßig wöchentlich länger als 48 Stunden. Vor allem die Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und im Schichtdienst hat in den letzten 20 Jahren zugenommen. Da ständige Mehrarbeit zum Teil drastische Auswirkungen für die Gesundheit hat, setzt das Arbeitszeitgesetz im Interesse der Beschäftigten der Mehrarbeit Grenzen.
Was sind aus arbeitsrechtlicher Sicht Überstunden und in welchem Umfang darf der Arbeitgeber erwarten, dass Mehrarbeit geleistet wird?
Die für den Arbeitnehmer maßgebliche Arbeitszeit ergibt sich regelmäßig aus dem Arbeits- oder Tarifvertrag. In Deutschland gilt in einigen Branchen tarifvertraglich noch die 37,5-Stunden-Woche. Arbeitet der Arbeitnehmer über die für sein Beschäftigungsverhältnis geltende Arbeitszeit hinaus, so leistet er Überstunden. Oftmals werden diese widerspruchslos akzeptiert und nicht jeder will Überstunden vermeiden. Aufgrund der damit verbundenen Mehrvergütung haben zahlreiche Beschäftigte den Wunsch nach ständiger Ableistung.
Wann darf der Arbeitgeber Überstunden anordnen und welche Grenzen gibt es?
Das Direktionsrecht gibt dem Arbeitgeber das Recht, die dem Rahmen nach umschriebenen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag näher zu konkretisieren. Bei einer 40-Stunden-Woche also die Verteilung der 40 Stunden auf die einzelnen Werktage. Die Anordnung der Überstunden muss sich aus einer eigenen arbeitsrechtlichen Grundlage ergeben. Häufig sind das sogenannte „Anordnungsklauseln“ im Arbeitsvertrag. Das in Deutschland geltende Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zum Schutz des Arbeitnehmers setzt diesem Direktionsrecht Grenzen. Es schränkt im Interesse der Gesundheit die Dauer der zulässigen Arbeitszeit ein.
Wann genau sich der Arbeitgeber außerhalb dieser Grenzen bewegt, ist in § 3 ArbZG geregelt. Hierin heißt es: „Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden.“
Der 10-Stunden-Tag soll also die Ausnahme sein. Er ist nur zulässig, wenn innerhalb des Referenzzeitraums von sechs Kalendermonaten ein Ausgleich stattfindet. Werktage sind alle Tage, die nicht Sonn- oder Feiertage sind. Auf den Arbeitsalltag übertragen ergibt sich folgende Rechnung: Der gesetzliche Höchstrahmen für die Arbeitszeit beträgt 6 x 8 Stunden, also 48 Stunden in 48 Wochen (52 Jahreswochen abzüglich 4 Wochen gesetzlicher Urlaub) = 2304 Arbeitsstunden jährlich.
Bewegt sich also die Anordnung des Arbeitgebers außerhalb dieser Grenzen, darf der Arbeitnehmer die Arbeitsleistung verweigern. Die zuständige Aufsichtsbehörde – in Hessen die Regierungspräsidien – überwacht die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes und ahndet Zuwiderhandlungen mit Geldstrafen von 2.500 Euro pro Verstoß bis hin zur Freiheitsstrafe.
Der Betriebsrat ist nur einzubeziehen, wenn die betriebsübliche Arbeitszeit vorübergehend verlängert oder verkürzt werden soll. Betriebsüblichkeit setzt einen generellen Sachverhalt voraus. Es reicht nicht die Betroffenheit des Einzelnen, sondern es muss eine Vielzahl von bestimmten Arbeitsplätzen oder eine bestimmte Arbeitnehmergruppe erfasst sein. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Kurzarbeit oder umgekehrt zusätzliche Arbeits- oder Rufbereitschaft eingeführt werden soll.
Was genau sind Überstunden?
Aber nicht jede Anwesenheit am Arbeitsplatz ist gleichbedeutend mit geleisteter Arbeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Pausen oder Zeiten der Rufbereitschaft sind selbstverständlich abzuziehen.
Auch muss für bestimmte Personen- und Berufsgruppen die Arbeit nach anderen Erfordernissen verteilt und eingeteilt werden. Die speziellen Bedürfnisse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer kennen die Sozialpartner am besten. So kann durch einen Tarifvertrag beispielsweise geregelt werden, dass die zulässige Tageshöchstgrenze über zehn Stunden hinaus verlängert werden kann, wenn in sie regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt. Das betrifft insbesondere die gesundheitliche Versorgung. Allerdings darf auch hier in einem Referenzzeitraum von einem Jahr die 48-Stunden-Woche nicht ohne Weiteres überschritten werden (§ 7 ArbZG).
Die tägliche, vergütete Arbeitszeit über acht Stunden hinaus kann zwar auch ohne Zeitausgleich durch Tarifvertrag verlängert werden. Dies erfordert aber zum einen die schriftliche Einwilligung aller Betroffenen, an deren Nichterteilung keine arbeitsrechtlichen Nachteile geknüpft werden dürfen, zum anderen muss die Gesundheit der Beschäftigten durch besondere Regelung sichergestellt werden. Dies kann beispielsweise eine regelmäßig stattfindende betriebsärztliche Untersuchung sein.
Im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes gilt grundsätzlich: Die Gesundheit der Beschäftigten sollte immer im Vordergrund stehen!
Der Urlaubsanspruch
Aus § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz ergibt sich für Arbeitnehmer bei einer Fünf-Tage-Woche ein Anspruch auf einen Mindesturlaub von 20 Werktagen pro Jahr. Üblich sind allgemein jedoch 25-30 Urlaubstage jährlich. Der Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. In den Folgejahren entsteht der volle Urlaubsanspruch jeweils am 01. Januar.
Übertragbarkeit des Urlaubsanspruchs
Grundsätzlich verfällt der nicht gewährte Urlaub mit Ablauf des 31. Dezember. Liegen dringende betriebliche oder persönliche Gründe vor, kann zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden, dass eine Übertragung des Resturlaubs auf das 1. Quartal des nächsten Kalenderjahres stattfinden soll. Mit Ablauf des 31.03. verfällt der gesetzliche Urlaubsanspruch endgültig. Der Arbeitgeber kann den Urlaubsanspruch für das laufende Kalenderjahr einzelvertraglich um den „Alturlaub” erhöhen, so dass dieser noch nach Ablauf dieser Frist genommen werden kann. Dies muss zwischen den Parteien aber ausdrücklich vereinbart werden.
Widerruf des Urlaubs
Ist der Urlaub vom Arbeitgeber (dem Vorgesetzten) genehmigt, darf er sich nicht einseitig von der Bewilligung des Urlaubs lösen. Er hat auch keinen Anspruch darauf, dass der Arbeitnehmer seinen bereits angetretenen Urlaub abbricht oder unterbricht. Nur in besonderen Notfällen, wenn etwa die Arbeitskraft den Zusammenbruch des Unternehmens verhindert und das Festhalten an der Urlaubsgewährung unzumutbar wäre, ist der Arbeitgeber ausnahmsweise zum Widerruf berechtigt.
Die Bindung an die Urlaubsfestlegung ist wechselseitig. Arbeitnehmer haben keinen Anspruch auf Neuzuteilung des bereits genehmigten Urlaubs, wenn sich ihre Urlaubswünsche verändern.
Krankheit während des Urlaubs
Erkrankt ein Arbeitnehmer während seines Urlaubs, werden ihm die durch ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nachgewiesenen Tage wieder als „zusätzlicher” Urlaub gutgeschrieben. Dies gilt ebenfalls bei Erkrankungen im Ausland (siehe auch eNews 13).
Urlaubsgewährung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Endet das Arbeitsverhältnis vor dem Ablauf des 30. Juni eines Kalenderjahres so vermindert sich der bereits entstandene Urlaubsanspruch entsprechend der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses im Beendigungsjahr auf 1/12 pro Monat, sofern noch nicht mehr Urlaub gewährt wurde. Endet das Arbeitsverhältnis nach dem 01. Juli, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf seinen vollen Jahresurlaub.
Beginnt der Arbeitnehmer in dem Jahr seines Ausscheidens eine neue Beschäftigung, so wird ihm der bereits von dem ehemaligen Arbeitgeber gewährte Urlaub angerechnet.
Eine Versetzung im arbeitsrechtlichen Sinne ist die einseitige, durch den Arbeitgeber vorgenommene Änderung des Arbeitsplatzes nach Ort, Zeit, Umfang oder Inhalt der Arbeit. Dabei ist zwischen dem individualrechtlichen oder arbeitsvertraglichen und dem kollektivrechtlichen oder betriebsverfassungsrechtlichen Versetzungsbegriff zu unterscheiden.
Individualrechtlicher Versetzungsbegriff
Der arbeitsvertragliche Versetzungsbegriff zielt im Unterschied zum betriebsverfassungsrechtlichen einzig auf die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes ab, die mit einer Änderung der Tätigkeit nach Ort, Art oder Umfang verbunden ist. Die Arbeitsbedingungen sind im Arbeitsvertrag meist nur allgemein beschrieben. Welche Änderungen der Arbeitgeber einseitig vornehmen kann, richtet sich nach dem Inhalt des Arbeitsvertrages. Dieser ist nach den Regelungen der §§ 133, 157 BGB auszulegen. Je nachdem wie eng oder weit der Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers im Arbeitsvertrag geregelt ist, kann diese Zuweisung kraft Direktionsrecht erfolgen, oder es ist eine Vertragsänderung im Wege der Änderungskündigung erforderlich.
In Arbeitsverträgen werden häufig Versetzungsklauseln verwendet. Diese Klauseln dienen der Erweiterung des Direktionsrechts und unterliegen der AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB, soweit sie vom Arbeitgeber bei Abschluss des Vertrags gestellt und vorformuliert sind.
Rechtsfolgen der individualrechtlichen Versetzung
Wenn die Versetzung wirksam vorgenommen wird, so hat dies die unmittelbare Änderung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit zur Folge. Der Arbeitnehmer ist damit verpflichtet, die geänderte arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit zu erfüllen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so stellt diese Arbeitsverweigerung eine arbeitsvertragliche Pflichtverletzung dar. Der Arbeitgeber ist dann berechtigt, mit entsprechenden Mitteln wie Abmahnung oder Kündigung zu reagieren. Der Arbeitnehmer verliert seinen Anspruch auf Arbeitsvergütung. Eine rechtswidrige Versetzung muss der Arbeitnehmer nicht befolgen.
Kollektivrechtlicher Versetzungsbegriff
Nach der Legaldefinition des § 95 Abs. 3 Satz 1 BetrVG versteht man unter einer betriebsverfassungsrechtlichen Versetzung die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist.
Der Betriebsrat hat bei Versetzungen gemäß § 99 BetrVG ein Mitbestimmungsrecht. Er ist in Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern über die geplante Versetzung zu unterrichten und bei Vorliegen eines Verweigerungsgrundes gemäß § 99 Abs. 2 BetrVG berechtigt, die Zustimmung zur Versetzung zu verweigern. Hierbei hat er die formellen Anforderungen des § 99 Abs. 3 BetrVG zu beachten.
Rechtsfolge der kollektivrechtlichen Versetzung
Die ordnungsgemäße Beteiligung des Betriebsrats ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der Zuweisung eines geänderten Arbeitsbereichs. Eine Versetzung ohne Zustimmung des Betriebsrats oder ohne Ersetzung der Zustimmung gemäß § 99 Abs.4 BetrVG führt dazu, dass der betroffene Arbeitnehmer die Versetzung bzw. die in ihr enthaltene Weisung des Arbeitgebers nicht befolgen muss. Der Arbeitnehmer ist nicht verpflichtet, an dem betriebsverfassungswidrig zugewiesenen Arbeitsplatz zu arbeiten. Die Weigerung hierzu stellt keine vertragswidrige Arbeitsverweigerung dar und lässt den Entgeltanspruch nicht entfallen.
Gibt es keinen Betriebsrat, bestimmt sich die Rechtmäßigkeit der Versetzung einzig nach den arbeitsvertraglichen Regelungen bzw. dem Direktionsrecht.
Betriebsverfassungsrechtlicher Weiterbeschäftigungsanspruch nach § 102 Abs. 5 BetrVG
Gemäß § 102 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) muss der Arbeitgeber vor einer ordentlichen Kündigung den Betriebsrat anhören. Der Betriebsrat wiederum kann einer ordentlichen Kündigung aus den in § 102 Abs. 3 BetrVG genannten Gründen binnen einer Frist von einer Woche widersprechen. Regelmäßig kommt ein solcher Widerspruch im Rahmen betriebsbedingter Kündigungen in Betracht.
Wird ein solcher Widerspruch ordnungsgemäß ausgeübt, eröffnet der Betriebsrat dem betroffenen Arbeitnehmer den Weg zu dem so genannten betriebsverfassungsrechtlichen Weiterbeschäftigungsanspruch gemäß § 102 Abs. 5 Satz 1 BetrVG.
Danach muss der Arbeitgeber einen ordentlich gekündigten Arbeitnehmer, der fristgerecht Kündigungsschutzklage erhoben hat, auch nach Ablauf der Kündigungsfrist bis zum rechtskräftigen Abschluss des Kündigungsschutzverfahrens weiterbeschäftigen. Allerdings muss der Arbeitnehmer vor Ablauf der Kündigungsfrist sein Weiterbeschäftigungsverlangen geltend gemacht haben. Liegen die Voraussetzungen des § 102 Abs. 5 BetrVG vor – ordentliche Kündigung, ordnungsgemäßer Widerspruch des Betriebsrats, fristgerechte Kündigungsschutzklage, Stellen des Beschäftigungsverlangens –, gilt das Arbeitsverhältnis auch über den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Klage gegen die Kündigung als fortbestehend. Dabei ist es unerheblich, ob die Kündigungsschutzklage in letzter Instanz gewonnen wird oder nicht. Für den Arbeitnehmer ist diese rechtliche Konsequenz vor allem für das Geltendmachen von Entgeltansprüchen von herausragender Bedeutung.
Der Arbeitgeber kann sich von der Pflicht zur Weiterbeschäftigung durch Erlass einer einstweiligen Verfügung gemäß § 102 Abs. 5 Satz 2 BetrVG befreien lassen, wenn die Klage des Arbeitnehmers keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet oder mutwillig erscheint, die Weiterbeschäftigung für den Arbeitgeber zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung führen würde oder der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war. Dieser Antrag kann während des gesamten Kündigungsrechtsstreits gestellt werden. Ist er erfolgreich, entfällt die rechtsgestaltende Wirkung des Weiterbeschäftigungsverlangens.
Wettbewerbsverbot während des Arbeitsverhältnisses
In einem bestehenden Arbeitsverhältnis ist der Arbeitnehmer gemäß § 242 Abs. 2 BGB verpflichtet, auf die Rechtsgüter und Interessen seines Arbeitgebers Rücksicht zu nehmen. Zu dieser Rücksichtnahmepflicht gehört auch die Verpflichtung des Arbeitnehmers zur Unterlassung von Wettbewerb. Dies gilt auch, wenn der einzelne Arbeitsvertrag keine ausdrückliche Regelung enthält. Dem Arbeitgeber soll sein Geschäftsbereich voll und ohne Gefahr nachteiliger Beeinflussung durch den Arbeitnehmer offen stehen. Der Arbeitnehmer darf deshalb insbesondere im „Marktbereich“ seines Arbeitgebers Dienste oder Leistungen nicht Dritten erbringen oder anbieten, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen.
Konsequenzen bei Zuwiderhandlung:
Verstößt der Arbeitnehmer gegen das vertragsimmanente Wettbewerbsverbot, so ist er dem Arbeitgeber zum Ersatz des ihm daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
Außerdem können Wettbewerbshandlungen des Arbeitnehmers dann eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen. Aufgrund der Schwere der Vertragspflichtverletzung ist eine Abmahnungen der Regel entbehrlich. Das Bundesarbeitsgericht hat mit seinem Urteil vom 23.10.2014 (Az. 2 AZR 644/13) zudem entschieden, dass ein Verstoß gegen das Verbot, während des bestehenden Arbeitsverhältnisses Konkurrenztätigkeiten zu entfalten, „an sich“ geeignet sei, einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung im Sinne des. § 626 I BGB zu bilden.
Nachvertragliches Wettbewerbsverbot
Nach dem Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis ist dieser grundsätzlich frei, sich eine neue Arbeitsstelle zu suchen und es ist ihm überlassen, welcher neuen Arbeit ernachgeht. Daraus folgt, dass in den Fällen, in denen während des Arbeitsverhältnisses ein Wettbewerbsverbot ausschließlich als vertragliche Nebenpflicht vorgefunden wird, ein nachwirkendes Wettbewerbsverbot nicht besteht.
Zur Begründung eines über die Beendigung des Arbeitsvertrages hinausgehenden Wettbewerbsverbots ist daher eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer notwendig. Allein die Regelung einer nachvertraglichen Verschwiegenheitspflicht beinhaltet nicht zugleich ein solches nachvertragliches Wettbewerbsverbot.
Eine gesetzliche Regelung zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot für Arbeitnehmer findet sich in § 110 GewO, der auf die §§ 74 ff. HGB verweist. Die §§ 74 ff. HGB regeln die Grenzen, in denen ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart werden kann:
- Es dürfen nicht mehr als zwei Jahre vereinbart werden (§ 74a Abs. 1 HGB);
- Es bedarf der Schriftform gem. § 74 Abs. 1 HGB, und dem Arbeitnehmer muss grundsätzlich die entsprechende Urkunde ausgehändigt werden;
- Erforderlich ist zudem, dass mit dem Wettbewerbsverbot zugleich eine Karenzentschädigung vereinbart wird, § 74 Abs. 2 HGB;
Nach § 74a Abs. 1 S. 1 HGB ist darüber hinaus Voraussetzung, dass ein berechtigtes geschäftliches Interesse des Arbeitgebers an dem Wettbewerbsverbot besteht. Vorausgesetzt wird insofern ein konkreter Bezug zwischen der bisherigen Tätigkeit und dem Gegenstand des Wettbewerbsverbots.
Die meisten Unsicherheiten bei Arbeitnehmern gibt es zum Thema Zeugnis. Wann wird es ausgestellt? Was muss inhaltlich enthalten sein und wie soll die Beurteilung aussehen? Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat jeder Arbeitnehmer gemäß § 109 der Gewerbeordnung einen Anspruch auf die Erteilung eines schriftlichen Zeugnisses. Man unterscheidet allgemein zwischen ‚einfachem’ Zeugnis, ‚qualifiziertem’ Zeugnis und Zwischenzeugnis.
Das einfache Zeugnis
Beschränkt sich das Zeugnis auf die Darstellung der Art und Dauer des Dienstverhältnisses, handelt es sich um ein sog. einfaches Zeugnis. Dieses Zeugnis muss die Tätigkeiten, die der Arbeitnehmer im Laufe des Arbeitsverhältnisses ausgeübt hat, vollständig und präzise beschreiben, beinhaltet aber keinen bewertenden Teil.
Das qualifizierte Zeugnis
Nahezu alle Arbeitnehmer beanspruchen jedoch ein sog. qualifiziertes Zeugnis, dessen Inhalt zudem eine Beurteilung der Leistung und Führung bzw. Verhalten des Arbeitnehmers im Arbeitsverhältnis enthält. Unter die Leistungsbeurteilung fallen vor allem Angaben zu Arbeitsumfang, -befähigung, -bereitschaft, zur Selbstständigkeit und Eigeninitiative, zur Arbeitsleistung, dem Tempo und der Ökonomie sowie zu Belastbarkeit, Sorgfältigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Ausdrucksvermögen und Verhandlungsgeschick. Die Verhaltens-/ Führungsbeurteilung beschreibt das Sozialverhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern und Dritten.
Oft endet das Zeugnis zudem mit einer Schlussformel, in der der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer für dessen Arbeit dankt, sein Ausscheiden aus dem Unternehmen bedauert und für die Zukunft alles Gute wünscht. Diese „Dankes-Bedauern-Formel” ist auch bei einem qualifizierten Zeugnis nicht zwingend – allerdings ein Gebot der Höflichkeit.
Der Zeugnisinhalt muss nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts wahr und verständlich sein. In diesem Rahmen soll er vom verständigen Wohlwollen des Arbeitgebers getragen, das heißt so formuliert sein, dass er das weitere berufliche Fortkommen des Arbeitnehmers nicht unnötig erschwert.
Das Zwischenzeugnis
Während des bestehenden Arbeitsverhältnisses hat ein Arbeitnehmer einen Anspruch auf die Erteilung eines Zwischenzeugnisses, sofern ein berechtigtes Interesse für die Ausstellung vorliegt. Ein solches ist zu bejahen bei einem Vorgesetztenwechsel, einer bevorstehenden Versetzung, der Ankündigung einer arbeitgeberseitigen Kündigung oder auch dem erstinstanzlichen Obsiegen eines Arbeitnehmers im Kündigungsschutzprozess.
Wird dem Arbeitnehmer trotz bestehenden Anspruchs gar kein Zwischenzeugnis/Zeugnis oder eines mit unzutreffendem Inhalt erteilt, kann er dagegen klageweise vorgehen, gegebenenfalls sogar im Wege der einstweiligen Verfügung. Dies sollte relativ bald nach Erteilung des Zeugnisses geschehen, da sowohl der Zeugnis- als auch der Zeugnisberichtigungsanspruch bereits nach einigen Monaten verwirkt werden kann.
Wenn Sie Fragen haben oder ausführlich beraten werden wollen, sprechen Sie uns an:
Telefon 069 242689-0 oder schreiben Sie uns ein E-Mail
